
Die Zauberlaterne als spannende Vorform des Kinos
Das Geheimnis ihrer Funktionsweise wird gelüftet.

- Phantasievoll gestaltete Laterna-Magica-Gehäuse.
Quelle »

„Neben einem Gehäuse findet sich eine Optik (mit zwei
konvexen Linsen), ein Hohlspiegel sowie eine Lichtquelle, die
im Innern der Laterne befestigt ist. [...] Um 1826 kam eine
sehr effektive Beleuchtungsart hinzu, die ein enorm helles
Licht lieferte: Es war das Drumondsche
Kalklicht  [...]. Zwischen Optik und Lichtquelle ermöglicht
ein Schacht mit einer Führung das Platzieren eines Bildes. Ein
auf Glas gemaltes oder gedrucktes Bild konnte hier hin- und
hergezogen werden. Manche Einsätze waren schon mit Mechanismen
versehen, die eine einfache Bewegung innerhalb desselben Bildes
zeigten. Auch finden sich Dreh- und Kurbelvorrichtungen, die
mitunter abstrakte Figurationen abbilden.“ (Kaufhold 2006: 52)
[...]. Zwischen Optik und Lichtquelle ermöglicht
ein Schacht mit einer Führung das Platzieren eines Bildes. Ein
auf Glas gemaltes oder gedrucktes Bild konnte hier hin- und
hergezogen werden. Manche Einsätze waren schon mit Mechanismen
versehen, die eine einfache Bewegung innerhalb desselben Bildes
zeigten. Auch finden sich Dreh- und Kurbelvorrichtungen, die
mitunter abstrakte Figurationen abbilden.“ (Kaufhold 2006: 52)
Ein klassisches Motiv wurde der „Rattenfänger“, ein schlafender
und schnarchender Mann, dem die Ratten in den Mund springen:
„Als Bilder verwendete man zunächst große, handbemalte
Glasplatten, die dann nach der Erfindung der Photographie durch
kleinere Diapositive ersetzt wurden.

- Ein Gleitrahmen kann leicht hin und her bewegt werden.
Quelle »

Damit die Bilder in richtiger Position auf der Bildbühne
erscheinen konnten, verwendete man so genannte Bildhalter, die
in vielfältigster Weise konstruiert waren. Neben der
primitivsten Form, dem Panoramabildhalter, der lediglich aus
zwei durch ein Stück Holz oder Blech miteinander verbundenen
Nutleisten bestand, nutzte man für die Zauberlaterne später vor
allem den Doppelbildhalter, bei dem die Bilder jeweils rechts
und links in einen Schieber gesetzt wurden, der mit zwei
Öffnungen versehen war. In einem Gleitrahmen wurde er hin und
her geschoben, so dass ein rascher Bildwechsel möglich war.
Die beweglichen Laternenbilder, eine bedeutsame Innovation auf
dem Gebiet der Projektion in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts, lassen sich im Wesentlichen in drei Gruppen
unterteilen, in Zieh-, Hebel- und Drehbilder.
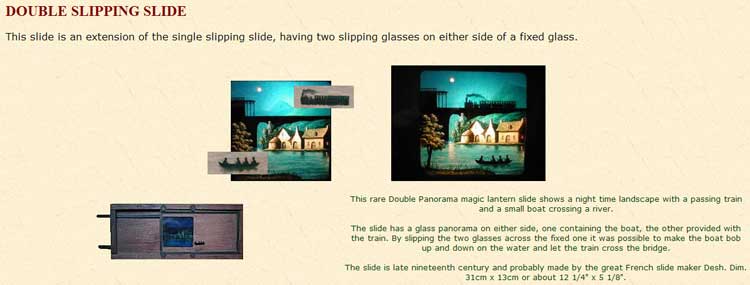
- Beispiel für ein Ziehbild. Quelle »

Das Ziehbild setzt sich aus zwei Glasplatten zusammen;
während die eine Platte fest im Holzrahmen steht, kann man die
andere an der unbeweglichen vorbeiziehen. Auf diese Weise wurde
zum Beispiel das Vorbeigleiten eines Bootes dargestellt. Das
Hebelbild besteht aus zwei runden Glasplatten, von denen eine
ebenfalls starr im Rahmen steht. Die andere lässt sich durch
einen Hebelmechanismus zum Teil um ihr Zentrum drehen. So ergab
sich die Möglichkeit, Schaukelbewegungen vorzutäuschen. Bei den
Drehbildern, die ähnlich aufgebaut sind wie die Hebelbilder,
lässt sich eine komplette Drehung durchführen, mit der man
beispielsweise Wasserräder darstellen konnte. Neben diesen drei
Bildarten gibt es noch die Chromatropen oder Farbenräder, bei
denen man beide Bilder in entgegengesetzter Richtung drehen und
ein wunderbares Farbenspiel erzeugen kann.“ (Kerstein, Weber
1981-1982: 6 ff)
Hier  können Sie sich Fotos von den
verschiedenen Bildern und ihren Rahmungen ansehen.
können Sie sich Fotos von den
verschiedenen Bildern und ihren Rahmungen ansehen.
Lisa Hochmuth



