
Bewegende Einsichten
Mobilität - ein Schlagwort zu dem Jedem ad hoc etwas einfällt. Dem Jobsuchenden der Appell an seine Flexibilität, dem Pendler der Slogan der Bahn, Menschen mit Behinderung die Frage, wie man am besten das gewünschte Ziel erreicht.
Mobilität- ein Schlagwort zu dem Jedem ad hoc etwas
einfällt. Dem Jobsuchenden der Appell an seine Flexibilität,
dem Pendler der Slogan der Bahn, Menschen mit Behinderung die
Frage, wie man am besten das gewünschte Ziel erreicht.
Diese an Alltagssituationen gebundenen Assoziationen sind so
eng an die eigenen Erfahrungen und die persönliche Wahrnehmung
gekoppelt wie der Begriff der Mobilität an Beweglichkeit.
Der folgende Text soll die Dynamik des Wortes sowohl durch
seine Hypertextstruktur als auch durch die Auffächerung des
Wortes in verschiedene mediale Assoziationsfelder
verdeutlichen.
Thomas Hensel entwirft in seinem Text ‚Mobile Augen‘ eine
Medienchronik, die den Zusammenhang von Mobilität und
Wahrnehmung in der vorkinematographischen Zeit herausstellt. Im
Folgenden soll auf seinen Text näher eingegangen werden.
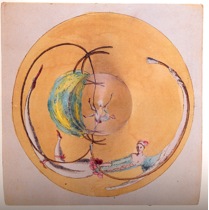
- Kegelanamorphose
Geht man zurück in der Geschichte der Medien und
konzentriert sich auf die Zeit vor dem Film  , wird bereits hier die Bedeutung
von Mobilität und ihrer Kopplung an die Wahrnehmung
herausgestellt. 1657 taucht das erste Mal der Begriff Anamorphose
, wird bereits hier die Bedeutung
von Mobilität und ihrer Kopplung an die Wahrnehmung
herausgestellt. 1657 taucht das erste Mal der Begriff Anamorphose  auf, hinter dem sich ein
verzerrtes Bild
auf, hinter dem sich ein
verzerrtes Bild  verbirgt (à Begriffsdefinition
verbirgt (à Begriffsdefinition  ). Erst die Veränderung
des Standpunktes und damit der Perspektive ermöglichen es dem
Betrachter, das Motiv zu entzerren.
). Erst die Veränderung
des Standpunktes und damit der Perspektive ermöglichen es dem
Betrachter, das Motiv zu entzerren.
Mit dieser „Dynamisierung der Wahrnehmung“, ist die Einsicht
verbunden, dass es nicht nur eine Erkenntnis gibt,
sondern viele Möglichkeiten Erkenntnisse zu gewinnen, abhängig
vom jeweiligen Standpunkt des Betrachters (Hensel 2002).
Nicht nur der lineare Prozess von Wahrnehmung und Erkenntnis
ist damit durchbrochen, sondern auch die Eindimensionalität der
Verbindung von Erkenntnisprozess und Sehen. Neben einem aktiven
Auge kommt es zu einer Verschaltung aller Sinnesorgane.
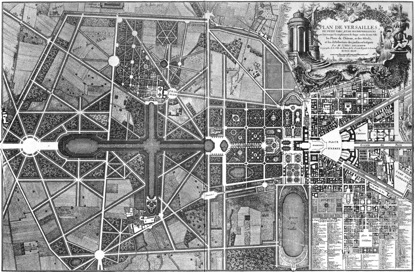
- Gesamtplan von Schloss und Plan, 1746. Das Schloss
befindet sich im rechten Bilddrittel. Quelle »

Eine „Mobilisierung der Wahrnehmung“ lösen die
Landschaftgärten des Absolutismus aus. Erst eine Bewegung des
Besuchers ermöglicht es ihm den Raum individuell zu erfassen.
Die Konzeption von Versailles  beispielsweise implizierte bei
ihrer Planung die Bewegung des Betrachters und lässt den Garten
nur durch dessen Mobilität erfahrbar werden (vgl. ebd.).
beispielsweise implizierte bei
ihrer Planung die Bewegung des Betrachters und lässt den Garten
nur durch dessen Mobilität erfahrbar werden (vgl. ebd.).
Durch die Erfindung der Eisenbahn  erfährt die an den mobilen
Körper gekoppelte Wahrnehmung ein zusätzliches extrinsisches
Moment der Beschleunigung, wodurch die Konturen der
Landschaft verschwimmen und die Außenwelt in Fragmente zerfällt
(à dies wurde auch von der Kunst aufgegriffen, wie beispielwese
von W. Turner, Rain, Steam and Speed
erfährt die an den mobilen
Körper gekoppelte Wahrnehmung ein zusätzliches extrinsisches
Moment der Beschleunigung, wodurch die Konturen der
Landschaft verschwimmen und die Außenwelt in Fragmente zerfällt
(à dies wurde auch von der Kunst aufgegriffen, wie beispielwese
von W. Turner, Rain, Steam and Speed  , 1844).
, 1844).
Moving Movies, an den Zug angehängte Kinowaggons, verknüpften
Ende des 19. Jahrhunderts sogar zwei Aspekte von Bewegung: die
reale und die filmische Illusion von Bewegung (vgl. ebd.).
Die Entwicklung der Fotografie enthält einen weiteren Aspekt,
der Mobilität inhäriert. Zunächst wird jedoch ein technisches
Defizit erkannt: die Differenz zwischen der Sequentialität der
dargestellten Bewegung und der Simultanität des darstellenden
Bildes kann nicht aufgehoben werden. Als Lösungsansatz wird die
Bewegung des Blicks genannt (vgl. Balzer 1996).
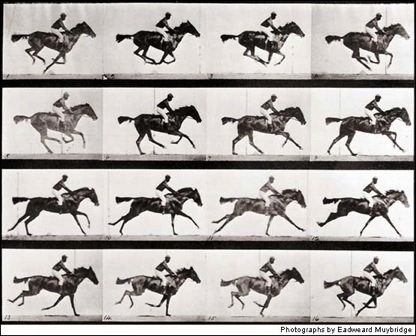
- Serienfotografie von Eadweard Muybridge. Quelle »

Die von Eadweard Muybridge entwickelte Serienfotografie
bedeutet eine Aufhebung von Simultanität und Sequentalität. Die
entstandenen Bilder lesen sich wie ein Text von rechts nach
links und lassen sich vom Betrachter am Ende der Bilderkette
als eine Bewegung zusammen setzen.
Von Muybridge inspiriert, entwickelt Etienne-Jules Mareys Ende
des 19 Jahrhunderts die Chronofotografie  . Diese zeichnet sich durch
eine simultane Einheit aus, die durch die sequentielle
Darstellung des sich bewegenden Körpers und deren Dauer gegeben
ist (vgl. ebd.) (à Buchcover von Werner Nekes
. Diese zeichnet sich durch
eine simultane Einheit aus, die durch die sequentielle
Darstellung des sich bewegenden Körpers und deren Dauer gegeben
ist (vgl. ebd.) (à Buchcover von Werner Nekes  ).
).
Der frühe Comic weist die gleichen Charakteristika auf und auch
der heutige Animationsfilm hat seinen historischen Vorläufer.
Lotte Reiniger schreibt Anfang des 20 Jahrhunderts
Filmgeschichte, indem sie den ersten Abendfüllenden Animationsfilm  erstellt.
Die einzelnen Glieder der aus schwarzem Tonkarton
ausgeschnittenen Figuren verband sie mit Draht. Dadurch war es
möglich die Figuren zu bewegen und ihnen so den Anschein
von Lebendigkeit zu verleihen.
erstellt.
Die einzelnen Glieder der aus schwarzem Tonkarton
ausgeschnittenen Figuren verband sie mit Draht. Dadurch war es
möglich die Figuren zu bewegen und ihnen so den Anschein
von Lebendigkeit zu verleihen.
Die Form der potenzierten Beschleunigung ist heute so aktuell
wie damals. Ein Sprung in die Gegenwart verdeutlicht, dass
Projekte – wie zum Beispiel die Theatergruppe Rimini Protokoll  – ebenfalls die Vernetzung von
Realität und Illusion anstreben und den Moment der Bewegung
einbinden. Folgt man dieser Idee, so bietet die Geisterbahn
– ebenfalls die Vernetzung von
Realität und Illusion anstreben und den Moment der Bewegung
einbinden. Folgt man dieser Idee, so bietet die Geisterbahn  ein weiteres Beispiel, welches diese
Charakteristika aufweist. Anfang des 20. Jahrhunderts
erfreute sie sich großer Beliebtheit. Die Bewegung der
Besuchers wurde gesteuert: er saß in Vehikeln die durch Trassen
geleitet wurden – im Zuge der Fahrt traf er immer wieder auf
Gestalten, die aus dem Dunkel auf ihn zu kamen. Ein bewegter
Betrachter trifft auf ein mobiles Bild (vgl. Hensel 2002).
ein weiteres Beispiel, welches diese
Charakteristika aufweist. Anfang des 20. Jahrhunderts
erfreute sie sich großer Beliebtheit. Die Bewegung der
Besuchers wurde gesteuert: er saß in Vehikeln die durch Trassen
geleitet wurden – im Zuge der Fahrt traf er immer wieder auf
Gestalten, die aus dem Dunkel auf ihn zu kamen. Ein bewegter
Betrachter trifft auf ein mobiles Bild (vgl. Hensel 2002).

- Sigmar Polke, Laterna Magica, 1988-1996, verschiedene Lacke auf Polyestergewebe, beidseitig bemalt, 16 Teile. Foto: Thomas Kellner
In der aktuellen Ausstellung ‚Blickmaschinen  ‘ des Museums für
Gegenwartskunst greift Sigmar Polke die Idee der
ganzheitlichen Erfahrung auf, die an die Vorstellung der
französischen Landschaftsgärtner des 17. und 18 Jahrhunderts
erinnert.
‘ des Museums für
Gegenwartskunst greift Sigmar Polke die Idee der
ganzheitlichen Erfahrung auf, die an die Vorstellung der
französischen Landschaftsgärtner des 17. und 18 Jahrhunderts
erinnert.
Erst durch eine Bewegung des Betrachters kann dieser dem Werk
näher kommen. Die individuelle Form der Bewegung um die
Installation und im Raum korrespondiert mit einer nicht
eindeutigen Bildwirkung.
Auf dieses Phänomen rekurriert auch die kinetische Kunst  . Ein umherwandernder Betrachter
nähert sich Kunstobjekten, die durch Mechanik in Bewegung
gesetzt werden (à Objekt im Gegenwartskunstmuseum
. Ein umherwandernder Betrachter
nähert sich Kunstobjekten, die durch Mechanik in Bewegung
gesetzt werden (à Objekt im Gegenwartskunstmuseum  ). Daraus
resultiert eine, sich aus zwei unterschiedlichen Quellen
speisende, Dynamik, die auf die Wahrnehmung Einfluss nimmt.
). Daraus
resultiert eine, sich aus zwei unterschiedlichen Quellen
speisende, Dynamik, die auf die Wahrnehmung Einfluss nimmt.
Bewegte Bilder, ein sich bewegender Betrachter. Der physische
Aspekt der Mobilität lässt sich durch einen nicht-physischen
erweitern. Man trifft immer wieder auf bewegende Bilder, die
den Betrachter emotional bewegt zurück lassen. Ausstellungen
wie die WorldPress Photos  und die der Wehrmacht
und die der Wehrmacht  liefern Beispiele hierfür. Letztere
wurde zum ersten Mal im März 1995 in Hamburg präsentiert.
Ausgangspunkt der Initiatoren:
liefern Beispiele hierfür. Letztere
wurde zum ersten Mal im März 1995 in Hamburg präsentiert.
Ausgangspunkt der Initiatoren:
„Die Wehrmacht führte 1941 bis 1944 auf dem Balkan und in der
Sowjetunion keinen ‚normalen Krieg‘, sondern einen
Vernichtungskrieg gegen Juden, Kriegsgefangene und
Zivilbevölkerung, dem Millionen zum Opfer fielen“ (vgl.
Balkenohl 2000).
Im Anschluss daran kam es zu heftigen Kontroversen bezüglich
der vermeintlichen einseitigen Präsentation bzw.
Pauschalisierung (à Resonanz auf die Wehrmachtsausstellung  ).
).
In einem Zustand des kontinuierlichen Wachstums befindet sich
zudem die virtuelle Mobilität in Form der Vernetzung  . Das Internet bietet mit online communities
. Das Internet bietet mit online communities  wie flickr und
youtube, Social Software
wie flickr und
youtube, Social Software  , Wikis
, Wikis  und Blogs
und Blogs  , Formate, die einen fast
unbegrenzten Datentransfer und damit einen beschleunigten
Austausch ermöglichen. Dass mobile Auge, das in der
Realität teilweise größere Anstrengungen unternehmen muss um
Details zu erkennen oder in die Ferne zu sehen wird durch das
Internet entlastet. So machen es Formate wie google earth
, Formate, die einen fast
unbegrenzten Datentransfer und damit einen beschleunigten
Austausch ermöglichen. Dass mobile Auge, das in der
Realität teilweise größere Anstrengungen unternehmen muss um
Details zu erkennen oder in die Ferne zu sehen wird durch das
Internet entlastet. So machen es Formate wie google earth  möglich, dass der User sich mit Hilfe der Maus näher heran oder
heraus zoomt, schwenkt und Einblicke erhält, die ihm ansonsten
verwehrt blieben.
möglich, dass der User sich mit Hilfe der Maus näher heran oder
heraus zoomt, schwenkt und Einblicke erhält, die ihm ansonsten
verwehrt blieben.
Der vermehrte Nutzen des Internets führt dazu, dass viele von
einer Parallelgesellschaft sprechen, die eine neue Form der
Wahrnehmung evoziert.
Doch auch die Gesellschaft in der Realität erfährt eine
Veränderung ihrer Blickkultur. Die teilweise großen Distanzen,
die Pendler zurücklegen korrespondieren mit einer Vielzahl von
Eindrücken, die vom Gehirn verarbeitet werden wollen. Vertraute
Bilder, die die Wahrnehmung als bekannt verbucht, werden
seltener – neue Reize häufiger. Als Konsequent nimmt der
Vorgang der Selektion an Bedeutung zu (à Studie zu Konsequenzen und Dimensionen des
Pendelns  ).
).
Auch das Thema der Migration  ist eng verstrickt mit dem der
Mobilität. Dirk Hoerder spricht in einem Aufsatz von dem
Wechselspiel aus Mobilität, Individuum und Gesellschaft (vgl.
Hoerder 2002).
ist eng verstrickt mit dem der
Mobilität. Dirk Hoerder spricht in einem Aufsatz von dem
Wechselspiel aus Mobilität, Individuum und Gesellschaft (vgl.
Hoerder 2002).
Wie ein Kaleidoskop an dem man dreht, um ein neues Muster
wahrzunehmen, ließe sich der Begriff der Mobilität durch
weitere Links immer feiner verästeln. Die vorgestellten
Beispiele sollen deutlich machen, dass Vieldeutigkeit des
Begriffs eine flexible Herangehensweise erfordert. Als
Konsequenz verbindet sich die Art der Analyse mit dem Inhalt.
Julia Jochem



