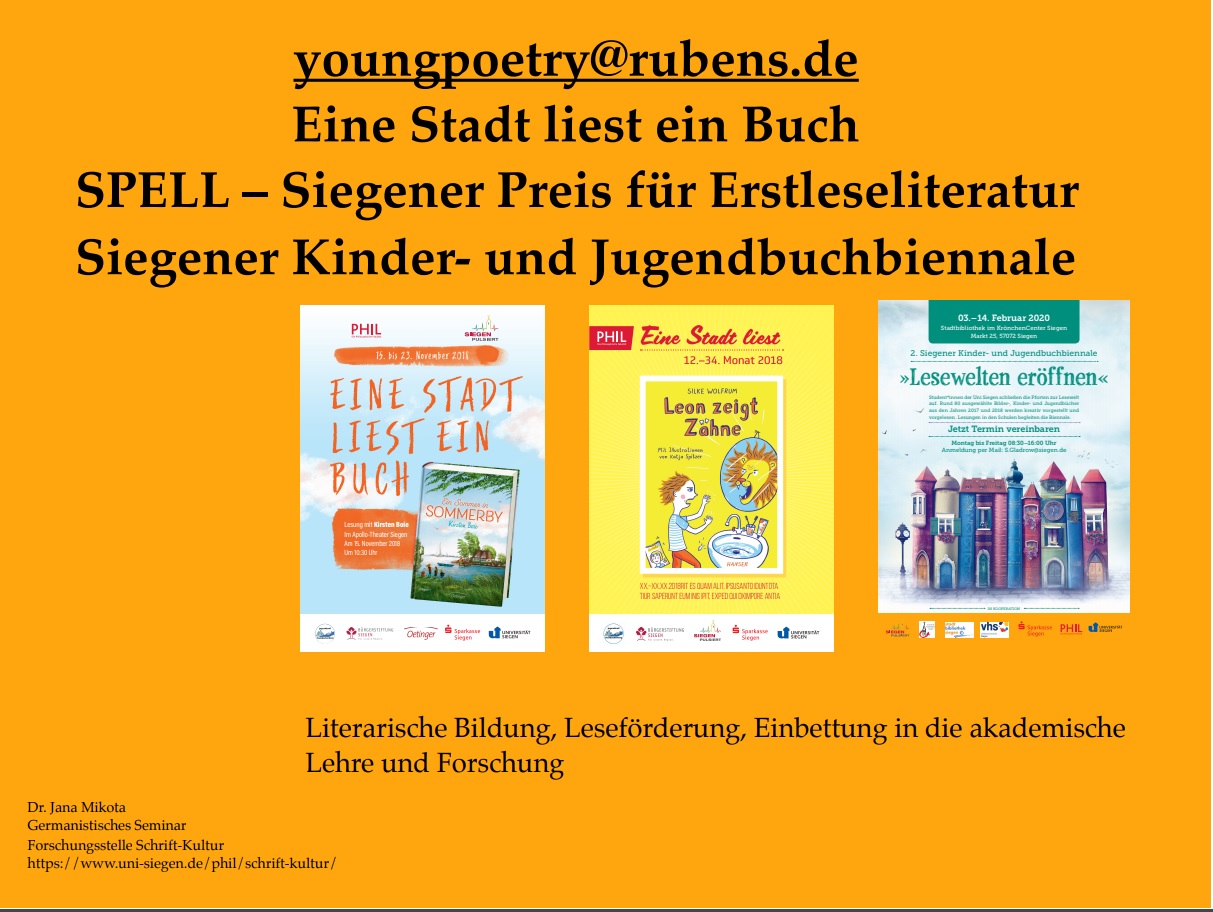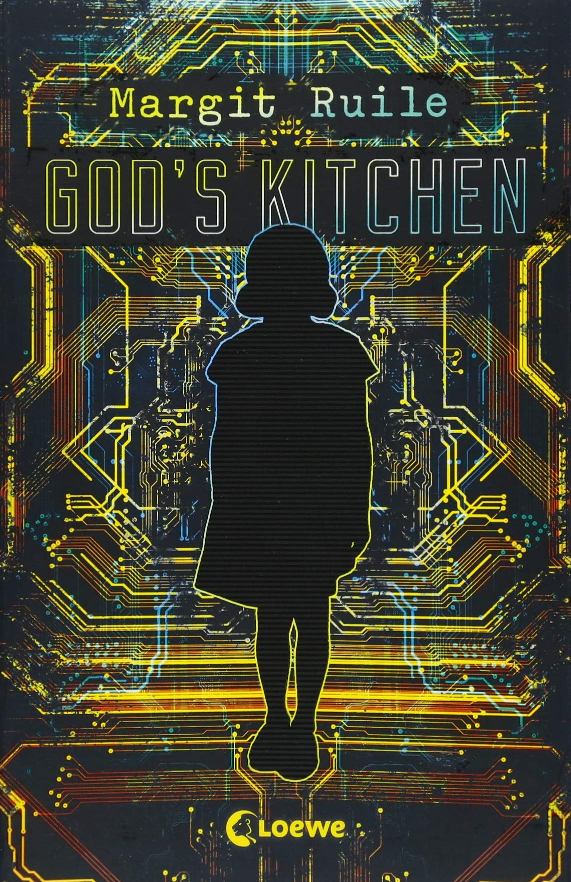YoungPoetry@rubens

„Ein Vorbild für uns alle“
Der Autor Reiner Engelmann las an der
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule aus seinem Jugendbuch „Der
Fotograf von Auschwitz“
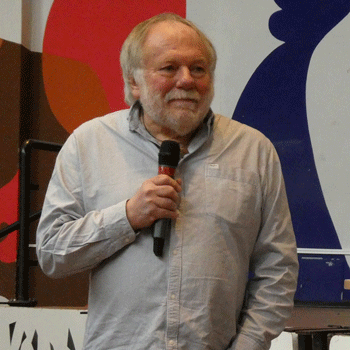
Wer erinnert an die Gräueltaten der
Nationalsozialisten, wenn die Zeitzeugen immer weniger
werden? Es sind die Aufzeichnungen der
Lebensgeschichten und Erinnerungen der Opfer und
manchmal auch die der Täter. Dazu gehört Reiner
Engelmanns Jugendbuch „Der Fotograf von Auschwitz“. Der
Autor aus dem Hunsrück reiste ins Siegerland, um die
Vita des polnischen Fotografen Wilhelm Brasse, der als
„Fotograf von Auschwitz“ bekannt wurde, an der
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule vorzustellen und mit
rund 250 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen
10 und 11 ins Gespräch zu kommen. Eingeladen worden war
Engelmann vom Haus der Wissenschaft der Universität
Siegen. Finanziert wurde die Lesung im Rahmen des
Formats YoungPoetry von der
Dieter-und-Christa-Lange-Stiftung. Die
Literaturwissenschaftlerin Dr. Jana Mikota stellte den
Autor vor: „Mit dem, was er macht, ist er ein Vorbild
für uns alle.“
Wilhelm Brasse wurde im Dezember 1917 im seinerzeitigen
Saybusch, dem heutigen Zywiec, in Schlesien geboren.
Seit 1935 arbeitete er als Berufsfotograf und fertigte
im entfernten Fotostudio seines Onkel Portraits und
Passfotos. Als junger Mann, so Engelmann, konnte Brasse
durchaus als „Lebemann“ bezeichnet werden, der gerne
feierte, tanzte und auch die Mädels mochte. Nach dem
Überfall Deutschlands auf Polen wollte sich Brasse in
seiner Heimatstadt zur polnischen Armee melden. Zywiec
war bei seinem Eintreffen aber bereits besetzt. Trotz
seiner Zweisprachigkeit - er beherrschte die polnische
und die deutsche Sprache – lehnte er es ab, als
Deutscher anerkannt zu werden. Gemeinsam mit Freunden
brach er im März 1940 auf, um sich in Frankreich dem
polnischen Widerstand anzuschließen. Kurz vor der
Grenze wurde die Gruppe verhaftet.
Brasse wurde gemeinsam mit 25 Menschen in eine winzige
Zelle gesperrt. Viele Gefangene überlebten bereits
diese erste Station als Häftlinge nicht. Engelmann: „Es
war reines Glück, diese vier Monate zu überleben.“
Brasse wurde im Sommer 1940 über Tarnow nach Auschwitz
transportiert. Das Vernichtungslager befand sich im
Aufbau. Brasse erhielt die Häftlingsnummer 3444
eintätowiert, die bis zur Befreiung des
Konzentrationslagers Mauthausen – seiner letzten
Häftlingsstation – im Jahr 1945 durch die US-Armee
seinen persönlichen Namen in der Anrede ersetzte.
In Auschwitz war Brasse zuerst im Straßenbau
eingesetzt, dann als Leichenträger, in der
Kartoffelschälerei und schließlich als Lagerfotograf.
Als Fotograf war er sogenannter Funktionshäftling.
Dieser Status ging mit besseren Lebensbedingungen und
auch Überlebenschancen einher. Das unendliche Leid und
zum großen Teil qualvolle Sterben der unzähligen
Mithäftlinge fand Darstellung in Engelmanns Buch, das
auf Gesprächen mit Wilhelm Brasse basiert. Tausende
Häftlinge fotografierte Brasse. Er sorgte dafür, dass
diese Fotografien nicht der von den Nazis angeordneten
Vernichtung anheimfielen, sondern bis heute als
Zeitzeugnisse und zur Erinnerung an die Ermordeten
dienen.
In der Aula der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule
herrschte über zwei Schulstunden hinweg Ruhe. Gebannt –
wenn nicht gar sprachlos – lauschten die Schülerinnen
und Schüler den Ausführungen des Autors. Die zweiten 90
Minuten standen für Fragen und Diskussion zur
Verfügung. Die jungen Leute wollten vieles wissen. Die
Fragen gingen nicht aus: Wie geht man mit
Holocaust-Leugnern um? Hatten die Lagerbediensteten
Freude daran, Menschen zu quälen, zu misshandeln und zu
ermorden? Wurden die Verantwortlichen zur Rechenschaft
gezogen und bestraft? Zeigten sie Unrechtsbewusstsein?
Kann so etwas wie die Nazi-Diktatur nochmals passieren?
Wie kann man vorbeugen?
Drei Stunden vergingen schnell. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich im Unterricht auf Lesung und Diskussion vorbereitet. Die Erzählung Reiner Engelmanns über das mörderische und menschenverachtende Geschehen in Auschwitz und anderen Vernichtungslagern während des Nazi-Terrors in Europa bewegte ungeachtet des Vorwissens tief.
© KK
„Bis die Sterne zittern“
Der Leipziger Autor Johannes Herwig war zu Gast bei
YoungPoetry an der Gesamtschule Freudenberg
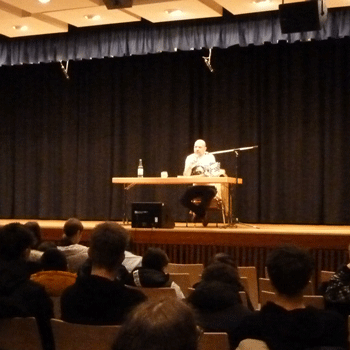
Der 27. Januar ist der Gedenktag an die Opfer des
Holocaust. Am 27. Januar 2025 jährt sich zum 80. Mal
der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers
Auschwitz. Aus diesem Anlass war der Jugendbuchautor
Johannes Herwig zu Gast an der
Esther-Bejarano-Gesamtschule Freudenberg. Mitgebracht
hatte er seinen Jugendroman „Bis die Sterne zittern“.
Dieser handelt vom Widerstand der Leipziger Meuten in
den 1930er Jahren.
Johannes Herwig weilte auf Einladung des Haus der
Wissenschaft im Siegerland. Finanziert wurde die Lesung
von der Christa-und-Dieter-Lange Stiftung. Rund 200
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9
füllten die Aula in Büschergrund. Viele der jungen
Menschen erlebten erstmals eine Autorenlesung. 45
Minuten lang stellte der Gast aus Leipzig Buch und
Inhalt vor. Protagonist Harro ist 15 Jahre alt, als er
im Jahr 1936 von einer Streife der Hitlerjugend
angegangen wird, weil er die Hakenkreuzfahne nicht
gegrüßt hatte. Aus der Patsche helfen ihm einige
Meuten, eine Jugendclique überwiegend aus dem
Arbeitermilieu, darunter der Nachbarsjunge Heinrich.
Die Meuten waren wie Wandersleute eher traditionell
gekleidet. Sie widersetzten sich der Gleichschaltung
und wollten sich nicht in nationalsozialistische
Organisationen eingliedern, sondern ihre Freiheit
bewahren. Gegen Ende der 1930er Jahre wurden viele von
ihnen verhaftet. Auch Harro wird am Romanende von der
Geheimen Staatspolizei in schwarzen Mänteln abgeholt
und zum Verhör gebracht.
Johannes Herwig schildert in seinem ersten Jugendroman
den Gewissenskonflikt, in dem sich seine Hauptfigur
Harro befindet. „Das Elternhaus ist still angepasst.
Die Eltern ducken sich weg. Es herrscht
Sprachlosigkeit.“ Harro erlebt, wie jüdische Freunde
misshandelt werden und gemeinsam mit der Familie
Deutschland verlassen. Er selbst entscheidet sich nach
einer kurzen Stippvisite bei der Hitlerjungend, seinen
eigenen Weg zu gehen. Im Anschluss an die Lesung gab es
viele Fragen. Auch die Autogrammkarten von Johannes
Herwig waren heiß begehrt.
© KK
Diskussion über den Wert
„Freiheit“
Johannes Herwig las aus seinem Jugendroman
„Scherbenhelden“

Am 8. November 2024 gingen drei Projekte Hand in Hand:
„Demokratie und Freiheit“ (finanziert von der
Universität Siegen aus Mitteln des Lebenslangen
Lernens, LLL), YoungPoetry (Lesungsreihe für Klassen ab
Jahrgangsstufe 7, finanziert von der
Christa-und-Dieter-Lange-Stiftung) und die Democracy
Machine (Gemeinschaftsprojekt des Strategiekreises
Verortung von Wissenschaft in der Stadt, WISTA). Zu
Gast im Haus der Wissenschaft am Siegener Obergraben
waren der Leistungskurs Q 2 der Bertha-von
Suttner-Gesamtschule Siegen sowie der Leipziger Autor
Johannes Herwig. Er las aus seinem Jugendroman
„Scherbenhelden“ und diskutierte mit den jungen
Menschen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dr.
Jana Mikota (Universität Siegen). Zum Abschluss durfte
der Kurs – aufgeteilt in vier Gruppen – sein
Diskussionstalent an der Democracy Machine (Zentrum für
Kunst und Medien Karlsruhe) erproben.
Für alle Teilnehmenden kam die Veranstaltung einer
Reise in die ostdeutsche Nachwendezeit gleich. Johannes
Herwig, 1979 in Leipzig-Connewitz geboren und groß
geworden, erlebte die Nachwendezeit als Punk. Er
studierte Soziologie und Psychologie, war viele Jahre
selbständig im Kulturbereich tätig und Mitbegründer der
Filmgalerie Phase IV in Dresden. 2013 widmete er sich
endlich seinem lang gehegten Traum: Autor zu werden.
Sein Roman „Scherbenhelden“ ist autobiografisch
inspiriert. Erzählt wird die Geschichte des Jungen
Nino, der in Leipzig bei seinem Vater – einem Schuster
– aufwächst. Die Mutter ist noch vor dem sogenannten
Mauerfall in den Westen ausgereist. Durch Zufall kommt
Nino mit Punks in Kontakt und schließt sich diesen an.
Er erlebt hautnah die Auseinandersetzungen mit
Neonazis. Herwig im Rahmen der Lesung: „Die Nazis haben
nicht in den Osten kommen müssen, sie waren schon immer
da.“ Zwischen den Zeilen sind die Schwingungen der
Wendezeit in Leipzig zu erahnen: Altvertrautes bricht
weg, das Neue ist noch nicht klar erkennbar,
Unsicherheit, Angst, Unverständnis, aber auch Wut und
Aggressionen dominieren viele Menschen. Der Lesung
schloss sich eine intensive Diskussion über Werte wie
die Freiheit an.
© privat
„Nenn keine Namen!“
Die niederländische Autorin Astrid Sy war zu Gast am
Weidenauer FJM-Gymnasium
_ineke_oostveen.jpg?m=e)
YoungPoetry, das junge Lesungsformat des Hauses der
Wissenschaft der Universität Siegen, startete
international ins Jahr 2024. Am 29. Januar las die
niederländische Autorin Astrid Sy aus ihrem neuen
Jugendroman „Nenn keine Namen“. Zu Gast war YoungPoetry
am Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium in Weidenau. Die
Lesung fand in englischer und deutscher Sprache statt
und wurde moderiert von Prof. Dr. Daniel Stein und Dr.
Jana Mikota von der Universität Siegen. Die
Terminierung der Lesung ist im Nachgang zum 27. Januar
zu sehen, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus.
Die Autorin Astrid Sy, geb. 1987, wuchs in Leiden auf.
Sie studierte Geschichte in Amsterdam und arbeitete
zunächst für die Internationale Holocaust Gedenkstätte
Yad Vashem in Jerusalem, später für die
Anne-Frank-Stiftung. Heute moderiert sie die
Geschichtssendung „Andere Zeiten" im niederländischen
Fernsehen und arbeitet für das neue Nationale Holocaust
Museum in Amsterdam.
Zum Roman: Amsterdam 1942. Heimlich schmuggeln Rosie,
Kaat und andere jüdische Kinder aus der Kinderkrippe,
um sie vor der drohenden Deportation zu bewahren. Sie
bringen sie zu Untertauchadressen im ganzen Land. Ihren
wirklichen Namen dürfen die Kinder von nun an nicht
mehr sagen. „Nenn keine Namen. Vergiss, wer du bist!“,
schärfen die jungen Leute ihnen ein. Die Arbeit im
Widerstand ist anstrengend und gefährlich, doch es gibt
kein Zurück. Eine Geschichte von Mut, Angst und
Hoffnung, von Verzweiflung, Liebe, Freundschaft und
Verrat. Der packende Roman der niederländischen
Historikerin Astrid Sy, der auf wahren Begebenheiten
beruht, geht unter die Haut.
© Ineke Oostveen
Hannas Regen
05. Dezember 2023, Ev. Gymnasium, Im Tiergarten 5-7,
57076 Siegen, Dr. Susan Kreller
Moderation: Dr. Jana Mikota

Josefin ist eine von der Sorte Ich verlass mich auf
dich. Eine, die angerufen wird, wenn sonst keiner Zeit
hat. Die nur aus Versehen mitfotografiert wird. Als
Hanna neu in ihre Klasse kommt, hofft Josefin, endlich
eine Freundin zu finden. Aber Hanna verhält sich
seltsam, ganz so, als sei sie schon fast wieder weg.
Sie ist still und abweisend, in sich selbst verborgen.
Als sich die beiden Mädchen wider Erwarten doch
anfreunden, wird Josefin klar, dass mit Hanna etwas
nicht stimmt. Ist sie in Gefahr? Muss sie beschützt
werden? Und ist Hanna am Ende gar nicht die, für die
sie sich ausgibt? (Quelle: Verlag Carlsen)
»Susan Kreller ist eine der sprachmächtigsten
Jugendbuchautorinnen in Deutschland.«
Augsburger Allgemeine
© fLy Ralf Menzel
Salzruh
06. Dezember 2023, 14.00 – 15.30 Uhr Altes Lyzeum,
Großer Saal, Franziskaner Straße 8, 57462 Olpe
Dr. Susan Kreller
Die MiAk Lesung findet in Kooperation mit dem Seminar
von Dr. Bernd Schulte „Die ersten 24 Jahre: Themen
europäischer Literatur(en) im 21. Jahrhundert“ statt und
ist öffentlich zugänglich
Moderation: Dr. Jana Mikota
In der Pension Bertoldi, einer heruntergekommenen Herberge in der Altmark, führen die Wirtin Oda Prager und das Zimmermädchen Maria Rosa ein strenges Regiment. Diejenigen, die ihrer Einladung gefolgt sind, müssen sich an den zugewiesenen Tischen einfinden und strikt an Regeln halten. Immerhin gibt es ab und zu ein Gläschen Sekt. Kaum eingetroffen, teilt man den Gästen ohne Begründung mit, dass sie zu ihrer Sicherheit nicht nach draußen gehen dürfen. So bleibt ihnen nichts als ein unbehagliches Miteinander und der Blick auf den dunklen Wald Salzruh. Dahinter winkt ein altes Schloss, einst ein beliebtes FDGB-Erholungsheim, und übt bis heute eine magische Anziehungskraft auf die Gäste aus. Wer wagt sich als Erstes hinaus? Der einstige Schuldirektor, dem die Wende zugesetzt hat, die hingebungsvolle Krankenschwester mit ihrem unermüdlich Ball spielenden Kind oder die dem Suff ergebene Kneipenwirtin? Das ältere Ehepaar, das eigentlich seine Goldene Hochzeit feiern wollte? Oder die beiden Verliebten, jung und schön, die bei den anderen Gästen für Irritationen sorgen?
In Salzruh verdichtet die preisgekrönte Autorin Susan Kreller mit einem ganz eigenen Humor Elemente des Schauerromans zu einem Kammerspiel voller tiefer Gedanken über Eingesperrtsein und Freiheit, Bleiben oder Gehen, Rebellion oder Versöhnung mit dem eigenen Schicksal. (Quelle: Schöffling Verlag)
Nachhaltigkeit und Demokratie fördern mit Jugendliteratur
Antrag von Katja Knoche & Dr. Jana Mikota, Universität Siegen, bei der Christa-und-Dieter-Lange-Stiftung
Kinder- und Jugendliteratur ist, darin dürften sich sowohl Literaturdidaktik als auch die Lesesozialisations- sowie die Kinder- und Jugendliteraturforschung einig sein, die Literatur, die den Kindern und Jugendlichen den Einstieg in literarische Welten ermöglicht, ihnen Anregungen zur Perspektivüberahme schafft und somit auch den Baustein legt, ob jemand Leserin/Leser oder Nichtleserin/Nichtleser wird. Literatur eröffnet ihnen zudem neue Welten, regt sie an, sich mit gesellschaftlichen Diskursen auseinanderzusetzen und kann ihnen so Anregungen geben, eigene Positionen zu entwickeln. Literatur funktioniert nach eigenen Regeln, die dann eine Perspektivübernahme ermöglichen und zum Nachdenken anregen. Begegnungen mit literarischen Texten an außerschulischen Lernorten können den Aufbau eines nachhaltigen Denkens unterstützen. Lesen, auch darüber herrscht Einigkeit, ist die Schlüsselkompetenz und dennoch erreichen uns seit Jahren alarmierende Zahlen: Jedes 5. Kind verlässt die Grundschule mit mangelnden Lesekenntnissen, was in der weiterführenden Schule nicht aufgehalten werden kann. Die Wirtschaft klagt über Fachkräftemängel. Ausgehend von diesen Überlegungen wurde das Projekt „Nachhaltigkeit und Demokratie fördern mit Jugendliteratur“ entwickelt, um insbesondere Jugendlichen aller Schulstufen die Möglichkeit zu geben, sich mittels Jugendliteratur mit den gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen und in einen Diskurs miteinander zu treten. Dabei ist es entscheidend, dass die Begegnung mit Literatur Jugendliche aller Schulformen und -stufen erreicht. Zugleich sieht sich das Projekt auch als ein Beitrag zur Leseförderung und nimmt dabei die Zielgruppe der Jugendlichen in den Fokus – eine Zielgruppe, die nicht immer leicht zu erreichen ist.
Das Konzept sieht vor, dass Klassen weiterführender Schulen zu vier unterschiedlichen Lesungen und Diskussionen pro Schuljahr eingeladen werden. Sie lernen vor Ort zunächst eine Autorin oder einen Autor, die/der sich bereits in ihren/seinen Werk mit wichtigen gesellschaftlichen Fragen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Pressefreiheit oder Parteienlandschaft auseinandergesetzt hat. Anschließend folgt eine Diskussionen mit namhaften Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, an der sich sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Autorin oder der Autor beteiligen. Jugendliche werden so angeregt, kritisch zu denken und sich auch zu positionieren. Eingebettet ist das Projekt in die bereits erfolgreiche und etablierte Reihe Poetry@Rubens, die in Kooperation mit dem Apollo-Theater stattfindet. Die Jugend-Reihe trägt daher den Namen YoungPoetry@Rubens.
„Heul doch nicht, du lebst ja noch“
Der Jugendbuchautorin Kirsten Boie war zu Gast bei YoungPoetry@Rubens.

Kirsten Boie wurde im Jahr 1950 in Hamburg geboren, fünf Jahre nach Kriegsende. Die Stadt an der Elbe war immer noch stark zerstört. Trümmer, Invaliden, Hunger, Einquartierung: Die bekannte Jugendbuchautorin hat den Weltkrieg nicht erlebt, ist aber mit den sichtbaren Folgen aufgewachsen. Der Lauf der Zeit bringt es mit sich, dass die Generation der Menschen, die Deutschland noch in Schutt und Asche erinnern, schwindet. Die medialen Angebote zum Gedenken an den 75. Jahrestag des Kriegsendes 2020 weckten bei der Hamburgerin Kindheitserinnerungen. Die Idee wurde geboren, ein Jugendbuch in dieser Zeit spielen zu lassen, indem die Folgen des Krieges erkennbar waren.
Im Mittelunkt stehen drei Jugendliche, die die Zeit des Nationalsozialismus unterschiedlich erlebt haben und sich jetzt mit den Folgen auseinandersetzen müssen. Jakob, dessen Mutter noch im Februar 1944 nach Theresienstadt deportiert wurde, überlebt im Versteck. Hermann trauert der „alten“ Zeit nach und Traute erlebt, wie geflüchtete Familien in ihrer Wohnung einquartiert werden. Ihre Welt ist auf unterschiedliche Weise zerbrochen. Hermanns Vater etwa kehrt beinamputiert aus dem Krieg zurück und ist für ganz alltägliche Dinge stets auf die Hilfe des Sohnes angewiesen. Dieser sieht aufgrund dieser Fürsorgeverpflichtung keine Zukunftsperspektive.
Jakob ist jüdischer Herkunft. Versteckt und versorgt wird er von einem Nazischergen, der sich dadurch Entnazifizierung erhofft. Jakob erfährt vorsätzlich nicht vom Kriegsende und glaubt weiter im Untergrund leben zu müssen. Als der Versorger nicht mehr auftaucht, muss er sich durch Diebstähle und Überfälle selbst versorgen, immer in der Angst erwischt und deportiert zu werden.
Traute ist das einzige Mädel der Straße und sie wohnt in einem der ganz wenigen unzerstörten Häuser. Im Haus sind Flüchtlinge einquartiert, die auf der Flucht ein Kind verloren haben.
Kirsten Boie verstrickt ganz bewusst unterschiedliche Schicksale. Nicht nur der Blick auf die geschundenen Kriegsbeginner und -verlierer war ihr wichtig, sondern auch der Blick auf millionenfach vernichtetes jüdisches Leben. Boie: „Mich interessierten die Schwierigkeiten der Menschen bei der Neuorientierung und die Frage, was genau denn so schwierig war.“ Mit ihrer bildhaften Sprache entführt die Autorin Leser und Zuhörer in die Lebens- und Gedankenwelt ihrer Protagonisten. Schuld spielt eine große Rolle, aber auch Freundschaft. Der Titel entstammt einem Zitat Hermanns, der sich mit Jakob anfreundet und so von der Judenvernichtung erfährt. Mit dieser Schuld kommt er nicht wirklich zurecht.
Der Roman „Heul doch nicht, Du lebst ja noch!“ ist in diesem Jahr im Oetinger Verlag erschienen. Kirsten Boie war im Rahmen des Uni-Jubiläums gleich zweifach in Siegen aktiv: Sie diskutierte mit Studierenden über ihr neues Buch und sie las vor Schülerinnen und Schülern aus ihrem neuen Werk im Rahmen des von der heimischen Lange-Stiftung unterstützten Formats YoungPoetry@Rubens. Kirsten Boie las nicht nur aus ihrem Buch, sondern erzählte auch aus ihrem Leben. Die Autorin hat selbst zwei Kinder adoptiert und engagiert sich in Afrika für Waisenkinder.
Foto: kk
Cornelia Funke las und sprach bei YoungPoetry über sich und ihre Fantasie-Welt«

„Ich bin die Wortfischerin und die Geschichtenerzählerin.“
Wer möchte in seiner Fantasie nicht gerne mal auf den Flügeln eines Drachen durch die Lüfte reiten? Die Autorin und Illustratorin Cornelia Funke macht dies möglich. Sie lädt auf Traumreisen ein – durch die Lüfte, auf die Berge, in die Tiefen des Meeres oder auch ins Wohnmobil des Weihnachtsmanns. Zu Gast war die berühmte Verfasserin von „Tintenherz“, „Herr der Diebe“ und „Reckless“ bei YoungPoetry, dem Literaturformat des Hauses der Wissenschaft für junge Leute, das von der Christa-und-Dieter-Lange-Stiftung finanziert wird. Cornelia Funke war digital zu Gast bei YoungPoetry@Rubens im Haus der Wissenschaft der Universität Siegen. Schulklassen zwischen Arnsberg, Siegen und Wissen hatten sich angemeldet, ebenso Studierende. Moderiert wurde die Veranstaltung am Dienstagvormittag von Dr. Jana Mikota.
Den Flyer zu dieser und anderen Lesungen finden
Sie hier
Foto: Michael Orth/Dressler Verlag
Die vielen Facetten eines Schulbusses

Siegen/Washington. In den USA ist der Autor Jason Reynolds ein Star. Nun war er digital zu Besuch in Siegen und hat zu sowohl für den Autor als auch für die Gäste ungewohnter Stunde - nämlich um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit - rund 200 Studierende, Schüler*innen und Kolleg*innen mit seinen Büchern und seinen Ausführungen zu Kinderliteratur, Poesie und Geschichte begeistert. Die Veranstaltung fand in Englischer Sprache statt und wurde von der Christa-und-Dieter-Lange-Stiftung finanziert. Das Gespräch, das vom Haus der Wissenschaft der Universität Siegen im Rahmen des Formats YoungPoetry@Rubens organisiert wurde, moderierten Prof. Dr. Daniel Stein und Dr. Jana Mikota von der Geisteswissenschaftlichen Fakultät.
Besonders eindrucksvoll war es, den Autor, der nicht nur von der Literatur, sondern auch von der Musik beeinflusst wurde, lesen zu hören. Rhythmisch, mit einem tiefen Timbre trug er nahezu ohne Luftholen u.a. eine Textstelle über den Schulbus vor. Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren auch im Zoom überrascht, wie pointiert und effektvoll Jason Reynolds über einen Schulbus und die vielen Facetten die dieser haben kann, schreibt. Alle merkten: Jason Reynolds schreibt gerne für seine Zielgruppe, kennt sie genau und setzt vor allem auf Authentizität. Er erzählte, dass Deutschland das erste Land war, in dem seine Bücher übersetzt wurden, aber auch über seine Arbeit an aktuellen Projekten und seine Erfahrungen mit Lesungen in anderen Ländern.
Die Lesung fand digital statt, hat aber mit Blick auf die positiven Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut funktioniert und zum Nachdenken und weiteren Gesprächen innerhalb der Klassen geführt. Literatur baut Brücken, Leserinnen und Leser lernen neue Welten und neues Denken kennen und Perspektiven weiten sich. Trotz Zoom ist es dem mehrfach ausgezeichneten Autor – erst vor zwei Wochen bekam er die Carnegie-Medal – gelungen, eine solche Brücke nach Siegen zu bauen.
Pilot geglückt: Erste Online-Lesung mit Schulen
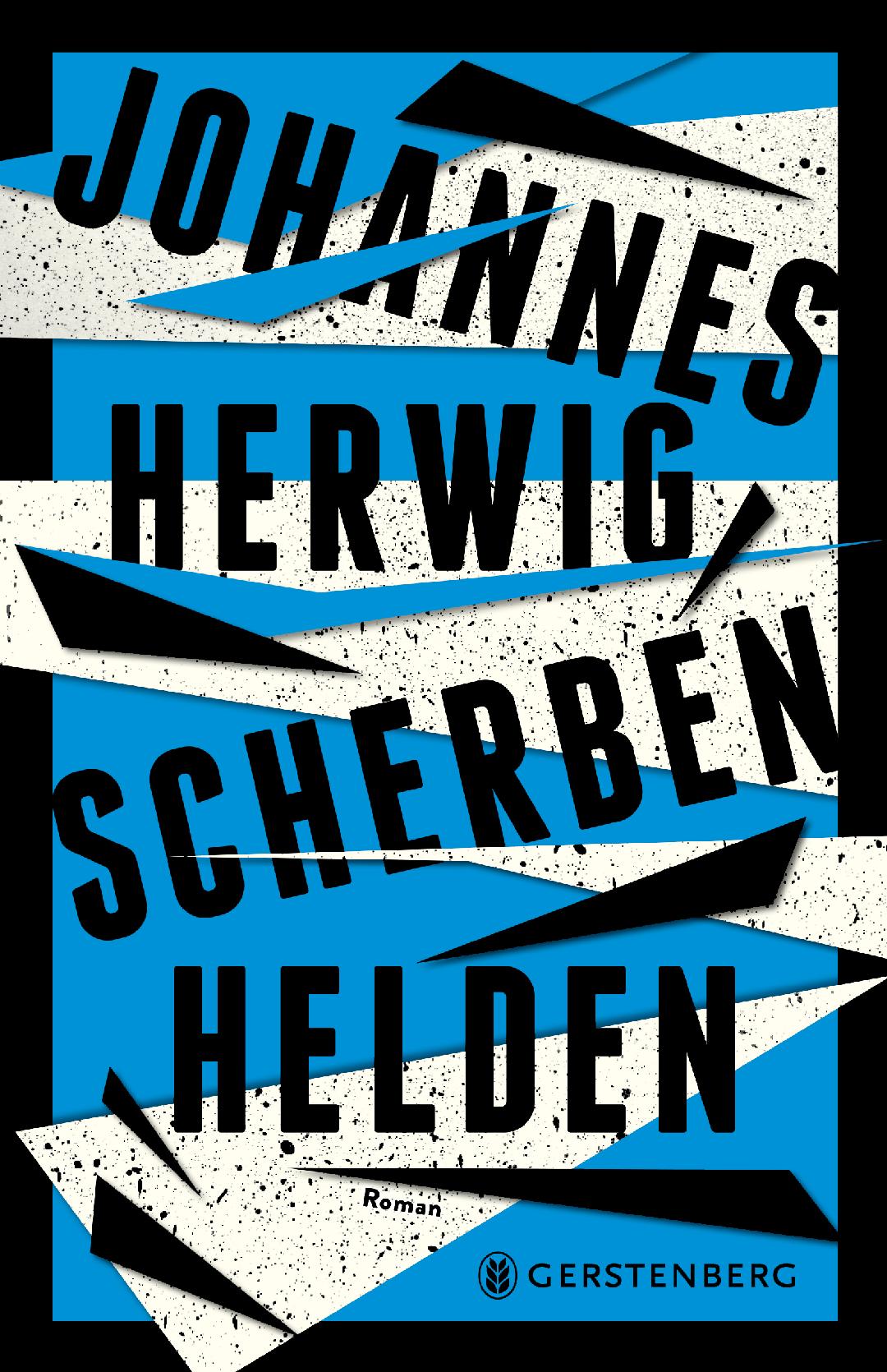
Corona schränkt ein – und Corona lädt ein, neue Wege zu beschreiten, die immer auch ein Maß an Ungewissheit einschließen. Ein Maß an Ungewissheit herrschte auch 1995 in Leipzig – sechs Jahre nach dem Mauerfall. Johannes Herwigs neuer Roman „Scherbenhelden“ spielt zur Wendezeit in der sächsischen Metropole. Die Lesung des gebürtigen Leipzigers, Jahrgang 1980, sollte im Rahmen der von der Christa-und Dieter-Lange-Stiftung ermöglichten Reihe YoungPoetry@Rubens eigentlich analog stattfinden. Durch Corona bedingt fand die Veranstaltung dann via ZOOM statt.
Johannes Herwig liest aus „Scherbenhelden“

Eine Stadt liest ein Buch
Das Haus der Wissenschaft der Universität Siegen geht mit Unterstützung der Christa-und-Dieter-Lange-Stiftung neue Wege bei der Literaturvermittlung. Seit 2007 existiert an der Universität Siegen in Kooperation mit dem Apollo-Theater das Format Poetry@Rubens, vom Namen her erinnernd an Siegens großen Stadtsohn Peter Paul Rubens.
Nun wird dieses Format erweitert durch ein Angebot primär für Oberstufenschülerinnen und -schüler. Denn: Ohne Lesen als wichtigste Grundkompetenz in unserer Wissensgesellschaft funktionieren Lernen und Bildung nicht. In einer sich rasant wandelnden Gesellschaft kommt der Literatur und dem Lesen auch die Funktion des innovativen Wegbereiters zu. Unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft gibt Literatur Anstoß, mittels der Perspektivübernahme (eigene) Positionen zu reflektieren, sie weckt Empathie und kann Grundlage für Veränderung und Verstehen sein.
Deshalb besitzt YoungPoetry@Rubens einen bilingualen Fokus, bei dem die Muttersprache der Autorinnen und Autoren sowie die Bedeutung der Übersetzung als Brückenschlag zwischen Sprachen und Kulturen unterstrichen werden.
Zum Auftakt des neuen Formats kommt am 12. Mai 2020 der norwegische Jugendbuchautor und Grafiker Øyvind Torseter mit seiner deutschen Übersetzerin Maike Dörries ins Siegerland. Zu Gast ist YoungPoetry@Rubens am Gymnasium Stift Keppel in Hilchenbach. Erfahren Sie mehr mit einem Klick!
God's Kitchen
Chi sieht aus wie ein Kind. Blass und schmal. Die Züge so bleich. Die Haut zart und durchscheinend. Lange Wimpern an den Lidern der mandelförmigen Augen.
Fast echt.
Denn Chi ist ein
Roboter, an dessen Programmierung die
19jährige Celine während ihres Praktikums am Institut
für neuronale Informatik mitarbeiten soll. Obwohl
Celine weiß, dass Chi nur eine Maschine ist, baut sie
eine Beziehung zu ihr auf. Aber als es zu ungeklärten
Todesfällen am Institut kommt, ist klar, dass das
Projekt gestoppt werden muss.
Ein atmosphärischer Thriller über künstliche
Intelligenz, computerdatenbasierte
Zukunftsprognosen versehen mit einem Schuss
Westworld. God's Kitchen
Flyer
Margit Ruile
Margit Ruile wurde 1967 in Augsburg geboren. Sie
studierte an der Münchner Filmhochschule, wo sie nach
ihrem Abschluss mehr als zehn Jahre in der Lehre tätig
war, drehte Dokumentationen und arbeitete als
Drehbuchlektorin.
Auch das Geschichtenerzählen lernte sie zuerst beim
Film. Später fand sie dann heraus, dass Schreiben sich
anfühlt, wie im Schneideraum zu sitzen - mit dem
riesengroßen Vorteil, dass man die fehlenden Szenen
nicht nachdrehen muss, sondern einfach erfinden kann.
Margit Ruile lebt mit ihrem Mann und ihren zwei
Töchtern in München.