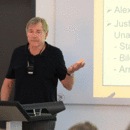Katja Knoche
E-Mail:
knoche@hdw.uni-siegen.de
Tel.: +49 (0)271 / 740 - 2513
Villa Sauer
Obergraben 23
57072 Siegen
Raum: 001
Karin Gipperich
E-Mail:
karin.gipperich@uni-siegen.de
Tel.: +49 (0)271 /740 - 2689
Villa Sauer
Obergraben 23
57072 Siegen
Raum: 003
„Keine Oligarchen-Yacht wurde jemals in Russland gebaut“
Der Osteuropa-Historiker Prof. Manfred Hildermeier referierte bei „Wissenschaft um 12“ über Russland und den Westen
Ist Rückständigkeit ein Schimpfwort, oder der nüchterne Befund eines Entwicklungsstadiums? Birgt Rückständigkeit die Chance auf Entwicklung auf der Basis getesteter Innovation, oder ist sie Zeugnis eigener Innovationsunfähigkeit? Zumindest birgt der Begriff der Rückständigkeit Diskussionspotenzial. Das erlebten die rund 90 Gäste bei „Wissenschaft um 12“ zum Thema des Buches von Prof. Dr. Manfred Hildermeier „Die rückständige Großmacht. Russland und der Westen“.
Der Göttinger Osteuropa-Historiker lud auf eine Wissensreise durch 1000 Jahre russischer Geschichte ein. Der Begriff der Rückständigkeit wurde in Russland bereits früh von politischen und sozialen Eliten geprägt. Hildermeier: „Das Bewusstsein der eigenen Rückständigkeit überwiegt bis in die heutige Zeit.“ Bereits im 15. Jahrhundert, zu Zeiten des Moskauer Metropoliten Isidor, deutet die Beschreibung einer Reise durch den Westen in diese Richtung. Im Vergleich beispielsweise zur westlichen Bauweise, Technik und Medizin wurde Russland als unterlegen erachtet. Hildermeier: „Diese Sichtweise bildete den Grundton der nächsten drei Jahrhunderte.“ Dabei fühlte sich die Kiewer Rus' nicht zuletzt auf der Basis vielfältiger Ehearrangements als zwar am Rande des Westens liegend, aber doch zugehörig. Erst das Schisma von 1054 ließ die Kontakte ob der religiösen Differenzen abbrechen und eröffnete eine Kluft zwischen Ost(Kirche) und West(Kirche). 1453 fiel Konstantinopel an die Osmanen. Das eröffnete rund eineinhalb Jahrhunderte später die Basis für die Translatio Imperio „Moskau das 3. Rom“.
Mitte des 16. Jahrhunderts begann Zar Ivan IV. mit der Anwerbung von Handwerkern aus dem „Westen“, vor allem aus Deutschland. Sein Nachfolger Boris Godunov wie auch der erste Romanov-Zar Michael setzen diese Bestrebungen fort. Peter der Große gilt als Begründer einer starken Westorientierung. Hildermeier: „Er stieß das Fenster zu Europa besonders weit auf.“ Unter Katharina der Großen erwuchs ein neuer Typus des russischen Adeligen: die Erziehung übernahmen Lehrer aus dem Westen; die jungen Adeligen gingen auf Kavalierstour durch Europa. Hildermeier: „Der russische Adel wurde so, wie Peter der Große sich das gewünscht hätte.“ Eine riesige Kluft zwischen der Entwicklung in der Stadt und dem Land blieb bestehen.
Der Invasion Russlands durch Napoleon folgte zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Rückbesinnung auf die russische Kultur und russische Werte. Ein antiwestlicher Konservativismus russischer Prägung, bestehend aus der Dreieinigkeit aus Autokratie, Orthodoxie und Nationalbewusstsein, entstand. Hildermeier: „Das Zarenreich wurde zum Gendarmen Europas.“ Eine Geheimpolizei wurde installiert. Dennoch, so Hildermeier, gab es auch gegenläufige Bewegungen. Ein Bildungssystem nach preußischem Vorbild wurde aufgebaut; die Industrie entwickelte sich auch mit bäuerlichen Arbeitnehmern, Beamte wurden erstmals an Universitäten ausgebildet – Qualifikation dominierte Herkunft. Die Niederlage Russlands im Krimkrieg (1853-56) stieß weitere Entwicklungen vor allem mit Blick auf Waffentechnik und Armee an. Westliche Investitionen in Russland stiegen an.
Der bolschewistische Umsturz 1917 sollte ein Gegenentwurf zum westlichen Kapitalismus sein. Zum ideologischen Hauptgegner avancierten die USA. Dennoch wurden die Vereinigten Staaten und vor allem der Unternehmer Ford verehrt. Hildermeier: „Der russische Marxismus basierte auf einer Technologisierungs-Ideologie. Das Land sollte modernisiert werden.“ Stalin führte die Zentrale Planwirtschaft ein: „Die Überfüllung der Pläne rechtfertigte jeden Terror.“ Zweieinhalb Fünfjahrespläne bildeten das Fundament einer modernen Industrie. Hildermeier: „Treibende Kraft war der Staat. Das technische Wissen und moderne Maschinen lieferte der kapitalistische Westen.“
Der Kalte Krieg beendete diese Kooperation. Aus dem besiegten Deutschland deinstallierte Industrien und deportierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führten nicht dazu, dass die Sowjetunion beispielsweise mit dem deutschen Wirtschaftswunder Schritt halten konnte. Zwei Kernanforderungen kristallisierten sich in der Sowjetunion heraus: die Schaffung von Wohnraum und die Versorgung der Bevölkerung mit Autos. In den 1960er Jahren entstanden über 12 Millionen kleine Privatwohnungen, die für eine städtische Mittelschicht erschwinglich waren. Unter Breschnew gab es eine Art Gesellschaftsvertrag: keine Mitsprache, aber mehr Wohlstand. Der „Wolga“ als FIAT-Ableger wurde ebenfalls für die Mittelschicht bezahlbar.
Mit dem Ende der UdSSR zu Beginn der 1990er Jahre entwickelte sich Vieles aus Sicht der Bevölkerung zum Schlechten. Jelzin stürzte das Land ins wirtschaftliche Chaos mit hoher Korruption und Kriminalität. Diese Zeit gebar die Oligarchen. Hildermeier: „Diese Situation hat Putin ins Amt gehoben.“ Der Boom der Erdölpreise führte zur „goldenen Zeit“ der anfänglichen 2000er Jahre: „Russland lernte unsicher und ungeschickt ein reiches Land zu sein“. Das Ende kam mit der Weltwirtschaftskrise 2008. Auch im Jahr 2014/15 zur Zeit der Krim-Annexion „dümpelte die russische Wirtschaft vor sich hin“. Die Industrie wurde nicht modernisiert; viel Geld floss in die Aufrüstung der Armee. Der Export heimischer Naturschätze finanzierte den Import westlicher Waren.
Ohne die konsequente Umsetzung der gegen Russland verhängten Embargos, so die Einschätzung Hildermeiers, könne Putin den 2022 begonnenen Krieg gegen die Ukraine noch jahrelang fortsetzen. Und: „Keine Oligarchen-Yacht wurde jemals in Russland gebaut.“