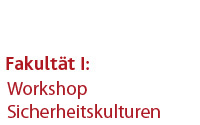Abstracts
Die Bundeswehr als Gewährleisterin von Sicherheit. Reformen und neue Recruiting-Strategien
Wir.Dienen.Deutschland. ... freiwillig?!?
Zu Beginn wird „Die Bundeswehr als Gewährleisterin von Sicherheit“ vorgestellt. In diesem Zusammenhang werden Reformen und neue Recruiting-Strategien thematisiert. Nach allgemeinen Ausführungen zu den Bereichen Organisation, Umstrukturierung und Auslandseinsätzen rückt das Thema Sicherheit in den Fokus. Für die Sicherheit spielt die Bundeswehr eine zentrale Rolle. Untersucht wird, wie der Leitgedanke „Sicherheit“ bei der Rekrutierung der Soldaten thematisiert wird. Herauszustellen gilt es hier, wie sich das Meinungsbild der Bevölkerung nach der Wehrdienstabschaffung darstellt und ob die Wahrnehmung der Sicherheit durch die Umstrukturierung gestärkt wurde. Es folgt eine Analyse von Social Media-Strategien der Bundeswehr zur Rekrutierung von neuem Personal. Dazu werden das Karriereportal und der Facebook-Internetauftritt der Bundeswehr untersucht. Ziel ist es, unter den besonderen Aspekten der sozialen Medien, Strategien der Bundeswehr für das Personalrecruiting darzustellen und abzuleiten. Das Thema „Jugendmarketing 2.0“ bezieht sich auf die Anreize und Bindung von Nachwuchs. Nach einer allgemeinen Erörterung von Strategien hinsichtlich des Jugendmarketings werden die Zielgruppe und deren Ansprache genauer untersucht. Aus der „Kraft der Community“ in Zeiten des „Web 2.0“ergeben sich diverse Online-Strategien für das zielgruppenspezifische Jungendmarketing der Bundeswehr. Die Ziele der Kommunikation von Sicherheit und der Aufbau beziehungsweise die Stärkung des Images der Bundeswehr, stehen dabei im Fokus der Untersuchung.
Die USA zwischen Patriot Act und Guantánamo Bay - Das Ringen um Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit nach 9/11
Der 11. September 2001 traf die Vereinigten Staaten von Amerika unerwartet und veränderte die Supermacht nachhaltig. Der Vorsatz weitere terroristische Angriffe zu verhindern bestimmt auch zehn Jahre nach den Terroranschlägen die Sicherheitspolitik der USA. Doch zu welchem Preis? Schon Benjamin Franklin sagte: „Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren“. Inwiefern dies auf die USA zutrifft, soll exemplarisch an zwei Reaktionen auf 9/11 dargestellt werden: der USA Patriot Act schränkt Bürgerrechte massiv ein, indem er Maßnahmen zur Überwachung intensiviert. Das Gefangenenlager der Guantánamo Bay Naval Base steht innen- und außenpolitisch aufgrund der dort herrschenden Bedingungen für die Insassen immer wieder in der Kritik der Öffentlichkeit. Für die Analyse werden die wichtigsten Akteure, ihre Argumente, Sichtweisen und Motive identifiziert und dargestellt, wie sich das Ringen um Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit seit den Anschlägen in den USA bis heute verändert hat.
Cyberterrorismus – Virtueller Terror und seine gesellschaftlichen Auswirkungen
Die Möglichkeiten durch das Internet scheinen praktisch unbegrenzt. Neue Informations- und Kommunikationstechnologien, ein steigendes Datentransferpotential, effiziente Distanzminimierung, Digitalisierung und Verbindung von Prozess- und Systemstrukturen, effektive Datenspeicherung sowie gesellschaftliche und kulturelle Vernetzung sind nur einige der positiven Seiten, die sich durch die zugrunde liegenden Netzwerkstrukturen etabliert haben. Doch die umfassende Vernetzung erweist sich gleichzeitig als sensibler Schwachpunkt. Die Anvisierung einer Netzwerkstruktur zu jeder Zeit und von jedem Ort, macht das Internet per se zu einer dauerhaften Angriffsfläche terroristischer Aktivitäten. Die absichtliche Schadenszuführung wirkt sich nicht nur auf den virtuellen Bereich, sondern darüber hinaus auch auf die Realität aus. Ob private Anwender, staatliche oder wirtschaftliche Institutionen, bei einer Vernetzungen mit dem Internet sieht sich jeder mit dieser Tatsache konfrontiert. Vorbeugende Maßnahmen bieten technische Systembarrieren und verstärkte Kontrolle. Doch die fortschreitende technische Entwicklung verursacht einen Wettlauf, bei dem sich Täter und Opfer in einem kontinuierlichen digitalen Kampf um die Kontrolle eines virtuellen Raumes bemühen, der sich scheinbar jeder Kontrolle entzieht. Doch welche Auswirkungen und Gefahren birgt dieser Konflikt? Mit welcher Art von Terrorismus sieht man sich konfrontiert? Wer ist eigentlich Terrorist und wer Opfer? Wie sieht das Internet als Handlungsraum aus? Welche Maßnahmen können und werden getroffen? Besteht überhaupt die Möglichkeit einer präventiven Kontrolle? Die Forschungsarbeit zur Thematik Cyberterrorismus wird sich diesen zentralen Fragestellungen widmen und sie mit der staatlichen und wirtschaftlichen Perspektive in Verbindung bringen. Eine Auseinandersetzung mit den Begriffen des Hacker und Cracker, die gesellschaftlich häufig als Synonym für Internetterrorismus gesehen werden, soll eine Trennschärfe für den verwendeten Begriff des Terrorismus etablieren. Auswirkungen von Kontrollversuchen auf die Internetkultur werden in einem abschließenden Ausblick behandelt und einen Ansatz für weitere Forschungsmöglichkeiten bieten. Das Gruppenprojekt soll durch die zugrunde liegende analytische Betrachtung einen Beitrag zu dem hier behandelten wissenschaftlichen Neuland leisten.
Angst und Schrecken am Frühstückstisch? - Eine deutsch-amerikanische Zeitungsanalyse zehn Jahre nach 9/11
Auch zehn Jahre danach haben die Menschen die Bilder der Terroranschläge vom 11. September 2001 so deutlich vor Augen, wie von kaum einem anderen Ereignis. Doch wie wird 9/11 anlässlich des zehnten Jahrestages der Terroranschläge medial aufgearbeitet und wie unterscheidet sich diese Aufarbeitung zwischen den USA und Deutschland? Um dieser Frage nachzugehen, wurden im Zeitraum vom 01.-14. September 2011 Texte und Bilder der deutschen Bild-Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung sowie der us-amerikanischen USA Today, dem Wallstreet Journal und der New York Times analysiert. Der Forschungsschwerpunkt lag dabei auf der Fragestellung, ob durch die Berichterstattung bei der deutschen beziehungsweise us-amerikanischen Bevölkerung eher ein Sicherheitsgefühl oder eine Bedrohungslage aufgebaut wird. Auch spielte der Unterschied zwischen der Berichterstattung der Boulevard- und Qualitätszeitungen eine Rolle.
9/11 HIER BEI UNS? - Maßnahmen zur Abwehr des islamistischen Terrors in Deutschland auf
Bundesebene am Beispiel der Bedrohungslage im Herbst 2010
Terroranschläge in Pakistan oder im Irak tauchen beinahe täglich in den Nachrichten auf, sie werden in unseren Medien mittlerweile nur noch nebensächlich behandelt. Doch wie sieht eigentlich der Terrorismus in Deutschland aus? Von welchen Akteuren gehen Gefahren aus, die die deutsche Sicherheit bedrohen? Welche Institutionen und Einrichtungen versuchen auf der anderen Seite, die Bundessicherheit zu garantieren? Welche Reglementierungen gibt es dazu von juristischer Seite und wie wird Terrorgefahr überhaupt erkannt? Im Herbst 2010 lagen dem Innenministerium konkrete Hinweise für einen geplanten terroristischen Anschlag gegen Deutschland für Ende November vor. Bereits in den Jahren zuvor war Deutschland immer wieder vermeintliches Ziel von terroristischen Aktivitäten. Zu einem Anschlag von größerem Ausmaß ist es bislang jedoch nicht gekommen. Die Frage, die sich daraus ergibt, lautet, welche Maßnahmen die Bundesrepublik Deutschland zur Abwehr und Vereitelung von terroristischen Angriffen ergreift. Konkret wird dies am Beispiel des Zeitraumes von Ende Oktober 2010 bis Anfang Dezember 2010 untersucht.
Muslime - Terroristen oder Terrorisierte? - Die Darstellung von Muslimen nach dem 11. September in den Medien
Rauschebart und Palästinenser-Schal? Freund oder Feind? Bedrohung oder Bedrohte? Selten haben Ereignisse die Welt so erschüttert wie die Terror-Anschläge des 11. Septembers 2001. Doch wurden Muslime deshalb zum internationalen Feindbild? Interessant ist zu hinterfragen, wie das Bild von Muslimen in den Medien verschiedener Länder aussieht. Sind die fiktionalen und non-fiktionalen Darstellungen islamfreundlich oder islamfeindlich? Lassen Berichterstattung und Filme nur Stereotypen zu oder erlauben sie ein differenziertes Bild? Und sind Muslime in den Medien ein Sicherheitsrisiko oder vielleicht selbst in Gefahr? Durch die Analyse von Artikeln aus deutschen und türkischen Zeitungen sowie der Filme „My Name is Khan“ (Indien, 2010), „Der verlorene Sohn“ (Deutschland, 2009) und „Four Lions“ (UK, Frankreich, 2010) sollen Antworten auf diese Fragen gegeben werden.
Terroralarm = Schubladenplan
Terroranschlag auf den Kölner Dom …. ein makaberer Scherz - unangebracht vielleicht - unmöglich jedoch nicht. Denn Terrorpotenzial gibt es auch hier in Nordrhein-Westfalen. Wie ist der Plan für einen Fall, der bisher noch nicht eingetreten ist? Spannend ist es deshalb zu hinterfragen, wie Institutionen wie Feuerwehr und Polizei auf den Fall der Fälle vorbereitet sind, in dem „Gefahrenabwehr“ plötzlich sehr konkret wird. Im Rahmen der Projektarbeit soll beantwortet werden, wie ein Land wie Nordrhein-Westfalen für einen solchen Einsatz aufgestellt ist. Wie bereiten sich die einzelnen Akteure vor, wer trägt welche Aufgabe und wie verläuft die Zusammenarbeit? Mit Hilfe von Experteninterviews mit einem Jurist und Staatstheoretiker, Vertretern des Staatsschutzes der Polizei Köln und dem Institut der Feuerwehr Münster sollen die Ablaufprozesse und Zuständigkeiten der einzelnen Akteure beleuchtet werden. Ein zwiespältiges Bild aus effektiver Prävention, Schnellschüssen der Politik, Kooperation und Bürokratie entsteht. Aber keine Sorge, in der obersten Schublade liegt ein Plan bereit.
„Frauen und Kinder zuerst!“ – Exemplarischer Vergleich zwischen sozialpsychologischen Verhaltensweisen in realen und fiktionalen Krisensituationen
In fiktionalen Katastrophenfilmen werden krisenhafte Ereignisse medial konstruiert. Wie die Betroffenen mit der Krise umgehen, folgt dabei typischen Mustern innerhalb des Genres. Überlebensstrategien prägen sich z.T. sogar im kulturellen Gedächtnis ein. Welche wiederkehrenden Verhaltensweisen sich identifizieren lassen und wie deren Erfolgsaussichten vor dem Wissen über reale Katastrophen bewertet werden können, wird in dieser Arbeit exemplarisch gezeigt.