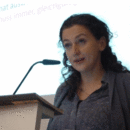Katja Knoche
E-Mail:
knoche@hdw.uni-siegen.de
Tel.: +49 (0)271 / 740 - 2513
Villa Sauer
Obergraben 23
57072 Siegen
Raum: 001
Karin Gipperich
E-Mail:
karin.gipperich@uni-siegen.de
Tel.: +49 (0)271 /740 - 2689
Villa Sauer
Obergraben 23
57072 Siegen
Raum: 003
Menschen müssen wohnen, egal wo
Dr. Darja Klingenberg analysierte die Wohnweisen russischstämmiger Migrantinnen und Migranten
„Wohnen“ lautet das Oberthema der öffentlich Vortragsreihe Forum Siegen im Wintersemester 2021. Unterschiedliche Aspekte des Themas werden behandelt. Jüngst war Dr. Darja Klingenberg von der Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/Oder) zu Gast. Ihr Thema lautete „Wohnsoziologie als kritische Theorie einer Migrationsgesellschaft“. Vorgestellt wurde die Referentin von Dr. Andrea Neugebauer vom Institut für Soziologie der Universität Siegen. Klingenberg, so Neugebauer sei akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie der Kulturwissenschaftlichen Fakultät und habe sich in ihrer Doktorarbeit mit dem Wohnen auseinandergesetzt („Wohnen nach der Migration. Materialismus, Aspirationen und Melancholie russischsprachiger migrantischer Mittelschichten“. Ihre Magisterarbeit befasste sich mit dem Thema „Humor und Migration. Phänomene der Grenzüberschreitung.“ Sie zeigte, dass diese scherzhaften Alltagskommunikationen dazu dienten, den Alltag in der Migration zu reflektieren, zu kommentieren, aber auch widerständige Selbstbilder zu entwerfen. Für diese Arbeit hat Darja Klingenberg den Augsburger Förderpreis für Interkulturelle Studien erhalten.
Ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind die Geschlechterforschung und Migrationssoziologie. Bezugnehmend auf den Medienphilosophen Vilém Flusser führte Darja Klingenberg ein: „Man hält die Heimat für den relativ permanenten, die Wohnung für den auswechselbaren, übersiedelbaren Standort. Das Gegenteil ist richtig: Man kann die Heimat auswechseln oder keine haben, aber man muss immer, gleichgültig wo, wohnen.“ Der Begriff „Heimat“, so die Referentin verschleiere Ungleichheiten und schließe aus. Die „Wohnung“ sei darauf ausgelegt, eigene Regeln und Wertevorstellungen zu etablieren. Im Englischen und Russischen seien Leben und Wohnen als home, house, homeland identisch, im Deutschen bestehe der Unterschied zwischen Wohnung und Heimat.
Die Wohnung sei für Migrantinnen und Migranten erster Begegnungsort in einem neuen Leben. Sie sei der Raum, in dem eigene Regeln gelten, der Raum temporärer Kompromisse und / oder der Raum, der langsame Verbesserungen und Aufstieg symbolisiere. Heimisch werden von Migrantinnen und Migranten durch Wohnen, Sprache und Arbeit werde in Deutschland teils immer noch als Bedrohung empfunden. Deshalb rücke das Wohnen allmählich in den Fokus von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Ein Blick auf russischstämmige migrantische Mittelschichten sei aufschlussreich. Diese Migrantinnen und Migranten gelten in der Forschung als unauffällig, unproblematisch und vorbildlich integriert. 20 städtische Wohnungen und deren Bewohnerinnen und Bewohner hat Darja Klingenberg analysiert. Drei Typen hat sie unterteilt:
1) Prekäre Haushalte, große Aspirationen und postmaterialistische Wohnweisen. Die Zimmer sind günstig, provisorisch eingerichtet, bieten wenig Komfort und sind nicht zum Sesshaft-Werden gedacht. Sie resultierten aus Ressourcenmangel, aber auch aus antimaterialistischem Selbstverständnis. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien überwiegend Anfang 30 und befinden sich in einer Übergangsphase zwischen der Suche nach einer neuen Wohnung und dem Frust in Anbetracht prekärer Arbeitsverhältnisse.
2) Bürgerliche Wohnweisen. Diese entsprechen dem Entwurf durchschnittlicher Mittelschichten, werden als Investition in eine stabile Zukunft gesehen. Grundlage ist der berufliche Erfolg, der als Leistung verteidigt, und damit stabilisiert wird, nicht so zu sein wie die anderen Russen.
3) Wohnungen von mit Deklassierung ringenden Migranten. Diese Migrantinnen und Migranten haben einstigen Aufstieg auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht wiederholen können und ihn an ihre Kinder und Enkelkinder delegiert. Um dies zu ermöglichen, werden postsozialistische Wohnträume durchaus mit IKEA oder vom Sperrmüll realisiert.