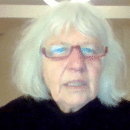Katja Knoche
E-Mail:
knoche@hdw.uni-siegen.de
Tel.: +49 (0)271 / 740 - 2513
Villa Sauer
Obergraben 23
57072 Siegen
Raum: 001
Karin Gipperich
E-Mail:
karin.gipperich@uni-siegen.de
Tel.: +49 (0)271 /740 - 2689
Villa Sauer
Obergraben 23
57072 Siegen
Raum: 003
Alleine wohnen ist für ältere Frauen die wichtigste Wohnform
Prof. Dr. Ruth Becker beschäftigte sich mit Wohnungspolitik und Lebensrealität
Menschen in Deutschland erfreuen sich statistisch gesehen zunehmend längerer Lebenszeit. Stand 2020 wird für Männer ein statistisches Lebensalter von 78,9 Jahren prognostiziert, für Frauen eine Lebenserwartung von 83,6 Jahren. Die Prognose der Lebenserwartung sowie auch unterschiedliche Lebensphasen und Lebensbrüche haben Auswirkung auf die Wohnsituation. Mit diesem Thema beschäftigte sich Prof. Dr. Ruth Becker (TU Dortmund) bei Forum Siegen. Ihr Thema lautete „Wie Wohnungspolitik die Lebensrealität (von Frauen) ignoriert und was dagegen zu tun wäre“.
Ruth Becker ist studierte Volkswirtin und habilitierte sich an der Universität Kassel in Fachbereich Stadtplanung und Landschaftsplanung. Von 1993 und bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2009 leitete sie das Fachgebiet Frauenforschung und Wohnungswesen in der Raumplanung und die Koordinationsstelle Netzwerk Frauenforschung NRW an der TU Dortmund.
Der Fokus ihres Vortrags lag auf der Wohnsituation vor allem älterer Frauen. Denn, so die Daten des Mikrozensus 2020, der Anteil allein lebender Frauen im Alter zwischen 65 und 75 liegt bei 66,6 Prozent (Männer: 18,5 Prozent), im Alter zwischen 75 und 85 Jahren bei 76,2 Prozent (Männer: 20,4 Prozent), und im Alter über 85 Jahren bei 77, 7 Prozent (Männer: 34,8 Prozent). Becker: „Alleine Wohnen ist für ältere Frauen die wichtigste Wohnform. Auch im Pflegeheim dominieren bei den Älteren die Frauen.“
Insgesamt gab es 2020 in Deutschland rund 40,5 Millionen Haushalte. 40,6 Prozent davon sind Ein-Personen-Haushalte. Wie geht die Wohnungspolitik mit diesen Zahlen um? Es gibt keine einheitliche Linie, skizzierte Becker. Das Verbleiben alter Menschen in den großen Familienwohnungen wird aber zumeist als Problem für die Wohnungsversorgung hervorgehoben. Nach Auszug der Kinder und/oder Versterben des Partners steige die genutzte Pro-Kopf-Wohnfläche an. Manchmal funktioniere der Wechsel in eine kleinere Wohnung, aktuelle Trends zeigten jedoch, dass der Verbleib in der angestammten Wohnung häufiger kostengünstiger sei. Der Mieterhöhungsmechanismus (bei Neuvermietung darf die Miete über dem Mietspiegel liegen, Modernisierungen dürfen anteilig umgelegt werden etc.) sei die Ursache; ältere Frauen verfügten häufig über kleine Einkommen und hätten daher weniger Chancen auf dem Wohnungsmarkt.
Die Politik favorisiere die Schaffung von Wohneigentum auch als Altersabsicherung. Die Förderung fokussiere in der Regel junge Familien. Mietwohnungen würden in Eigentum umgewandelt. Alte, Arme, Alleinerziehende und Ausländer seien besonders von Gentrifizierung betroffen. Sozialem Wohnungsbau werde nur eine Übergangsdauer zugebilligt, die Zweckbindung betrage teils nur noch zehn Jahre. Die Anzahl der geförderten Wohnungen gehe zurück. Auch beim sozialen Wohnungsbau seien Familien priorisiert. Erst in den 1970er Jahren rückten Alleinerziehende in den Blickpunkt. Mutter und Kind gälten als Zwei-Personen-Haushalt mit Bedarf an zwei Zimmer, Küche, Bad. Der Bedarf an Schlaf- und Kinderzimmer bleibe häufig unberücksichtigt.
Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe verdeutlicht: Das Zuhause kann für Frauen ein gefährlicher Ort sein. 2020 wurden in Deutschland 139 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen habe berechnet, dass durch häusliche und sexualisierte Gewalt in Deutschland tagtäglich Kosten in Höhe von rund 148 Mill. Euro entstehen. Eine eigene Wohnung sei für Frauen unabhängig von deren Finanzlage häufig existentiell, so Becker.
Lösungsansätze sieht die Wissenschaftlerin im Bereich autonomer Fraueninitiativen. Bereits die erste Frauenbewegung habe Wohnheime und Genossenschaften für alleinstehende Frauen gegründet. Diese Initiativen setzten sich nach dem Zweiten Weltkrieg und auch in der 2. Frauenbewegung ab den 1980er Jahren fort. Bei der Förderung von Wohnprojekten nur für Frauen werde aber die Frage nach dem Gleichheitsgrundsatz gestellt. Becker benennt positive wie negative Seiten bisheriger Projekte, auch des oft diskutierten Mehrgenerationenhaus, welches bislang lediglich eine Erfolgsgeschichte von wenigen Besserverdienenden ist. Ökonomische und soziale Faktoren sind also gleichermaßen zu berücksichtigen, um eine Wohnungspolitik für alle Geschlechter zu realisieren.