
Der Siegeszug der Laterna Magica von den wissenschaftlichen Eliten zum Jahrmarkt-Publikum
Ein kurzer Abriss des soziokulturellen Kontextes von Laterna Magica-Vorführungen.
Zu Beginn ihrer Erfindung Mitte des 17. Jahrhunderts war die
Laterna Magica nur in wissenschaftlichen Kreisen bekannt.
Populär wurde sie durch die Vorführung auf Jahrmärkten im 18.
Jahrhundert:
„In den ersten 150 Jahren ihrer Existenz hat die Laterna
magica ihren Ort neben der Präsenz in Wunder resp.
Kuriositäten-Kabinetten und den Salons der gehobenen Stände ab
dem 18. Jahrhundert auf öffentlichen Plätzen, in Gasträumen,
ländlichen Scheunen etc. gefunden. Ihre Praxis wird zunehmend
von reisenden Laternisten dominiert, deren Vorführungen
angesichts der zur Verfügung stehenden Lichtquellen - meist
eine Öllampe - allerdings vor einem zahlenmässig begrenzten
Publikum stattfinden müssen. Noch ist das Projektions-Gewerbe
also überwiegend ambulant; mit nahezu identischem und
begrenztem Bildbestand wird über längere Perioden ein
weitgehend gleichbleibendes Programm aus zumeist Komischem,
Groteskem und Religiösem an wechselnden Orten präsentiert.
Häufig werden die Vorführugen, zu deren erweitertem Repertoire
oft auch der Guckkasten zählt, von einem Leierkasten
musikalisch begleitet.“ (Hick 1999:145)
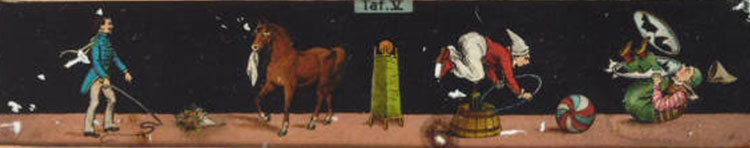
- Komische Szene. Quelle »

Die umherziehenden Schausteller („Savoyarden“) malten die
Bilder für die Laterne selbst von Hand auf Glasplatten und
zogen mit nur sehr wenig verschiedenen Motiven von Ort zu Ort.
Das Jahrmarkts-Publikum ließ sich von dem kargen Angebot nicht
stören:
„Das Interesse des Volkes an diesen Veranstaltungen war
enorm groß, da sich im Alltag des 18. Jahrhunderts kaum Bilder
fanden. Die Savoyarden kamen von weit her, was sie zusätzlich
interessant machte. Da man den Ort seiner Geburt in der Regel
nicht verließ - Handwerker waren hier eine Ausnahme -, gab es
einen Mangel an Informationen und Nachrichten. Im Sommer fanden
die Darstellungen auf Jahrmärkten und öffentlichen Plätzen
statt. Neben Reisedarstellungen finden sich
naturwissenschaftliche Themen, höfische Jagdszenen und
Kriegsdarstellungen. Im Winter wurden die fahrenden Darsteller
oft von Bürgern in ihre Häuser eingeladen. Die Aufführung eines
Savoyarden im privaten Bereich wurde auch als „Galantee Show“
bezeichnet. Gezahlt wurde mit Geld oder einem Abendessen im
Kreis der Familie.“ (Kaufhold 2006:59)
Henry Langdon Childe (1782-1874), der mit seinen
Nebelbilder  -Schauen für Furore sorgte, durfte seine
Vorstellungen in den bekanntesten Theatern Englands vorführen,
mitunter vor royalem Publikum. In Wien ließen sich Gelehrte und
Künstler, Literaten und Staatsmänner von Ludwig Döbler
(1801-1864) mit Nebelbilder-Schauen faszinieren. Und Richard
Wagner ließ 1876 bei der Erstaufführung von „Ring des
Nibelungen“ in Bayreuth den Walkürenritt auf den
Hintergrundprospekt projizieren. Dies hob das populäre
Bildmedium in die Kunst und steigerte dessen Seriösität.
-Schauen für Furore sorgte, durfte seine
Vorstellungen in den bekanntesten Theatern Englands vorführen,
mitunter vor royalem Publikum. In Wien ließen sich Gelehrte und
Künstler, Literaten und Staatsmänner von Ludwig Döbler
(1801-1864) mit Nebelbilder-Schauen faszinieren. Und Richard
Wagner ließ 1876 bei der Erstaufführung von „Ring des
Nibelungen“ in Bayreuth den Walkürenritt auf den
Hintergrundprospekt projizieren. Dies hob das populäre
Bildmedium in die Kunst und steigerte dessen Seriösität.
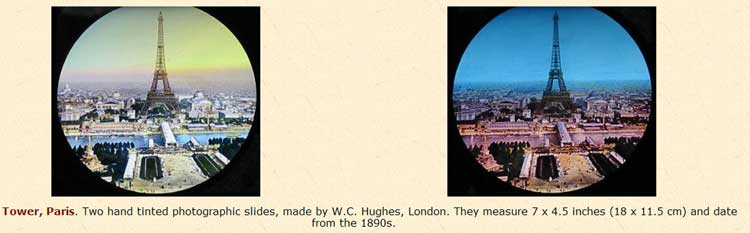
- Nebelbild vom Pariser Eifelturm (Tag und Nacht).
Quelle »

Die Industrialisierung machte die Zauberlaterne allen sozialen
Schichten zugänglich. Sie hatte dadurch Anteil an der visuellen
Alphabetisierung ganzer Bevölkerungsschichten. Es folgte auch
der Einsatz der Laterna Magica zu pädagogischen und
Bildungszwecken. Si e diente u.a. als vergrößernder Projektor
von Insekten oder dem Beobachten des Blutkreislaufes von
Fröschen.
Es entstand letztendlich auch eine frühe Form des „Heimkinos“,
bei der die Laterna Magica in den privaten Gebrauch überging.
Lisa Hochmuth



