Band 11: Europäische Integration und Wettbewerbspolitik
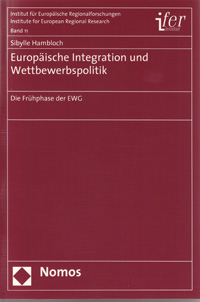
Sibylle Hambloch
Europäische Integration und Wettbewerbspolitik. Die Frühpase der EWG.
Sibylle Hambloch: Methodischer Ansatz/ Forschung und Quellenlage
Aus der Einleitung:
1.1. Methodischer Ansatz
Angesichts der Erweiterung der EU sowie der Diskussion um die Annahme der Verfassung stehen auch ihre Institutionen auf dem Prüfstand. Der europäische Integrationsverlauf hat ein bisher nicht da gewesenes Institutionengefüge geschaffen, das europäische Staaten miteinander verklammert, das aber keinem eindeutigen und vertrauten Verfassungsmodell entspricht. Es existiert weder eine klare Gewaltenteilung noch eine eindeutige Kompetenzabgrenzung zwischen der europäischen und der mitgliedstaatlichen Ebene, woraus Spannungen, Problembearbeitungslücken und Überschneidungen resultieren. Europäische Integration lässt sich deshalb als dynamisch und evolutionär charakterisieren. In diesem Kontext soll die vorliegende Mikroanalyse europäischer Politik einen Mosaikstein zum besseren Verständnis der E(W)G als Gebilde „sui generis“ liefern.
Im Folgenden werden einige zentrale, für die Studie grundlegende Begriffe definiert. Es handelt sich hierbei um die Auswahl von Definitionen aus jeweils einer Vielzahl von existierenden Definitionen des jeweiligen Begriffes.
„Integration“ wird in dieser Studie definiert als „[…] die friedliche und freiwillige Zusammenführung von Gesellschaften, Staaten und Volkswirtschaften über bislang bestehende nationale, verfassungspolitische und wirtschaftspolitische Grenzen hinweg.“ Der Begriff „Integration“ bezeichnet hier nicht einen Zustand, sondern einen Vorgang und „evolutionäre Integration“ den freiwilligen Aufbau und die Weiterentwicklung der gemeinsamen politischen Entscheidungsfindung, der gemeinsamen internationalen Interdependenz, der gesellschaftlichen Verflechtung und des gemeinsamen Bewusstseins im Rahmen der E(W)G und der EU. Es steht der Aspekt der gemeinsamen politischen Entscheidungsfindung im Vordergrund, der Institutionen, Kompetenzen und Verfahren umfasst. Eine „Entscheidung“ umfasst dabei die Selektion aus einer Mehrzahl von Gestaltungsmöglichkeiten und damit die Reduktion von Unsicherheit und Streitpunkten. Ergebnisse bilden dabei Zwischenetappen, aus denen sich Entscheidungen konstituieren. Dabei gilt es, den Begriff „Entscheidung” vom Terminus „Politik” abzugrenzen: Politik ist ein Entscheidungsergebnis darüber, was wie zu tun ist und wie entschieden werden soll, was zu tun ist. Entscheidungen sind die konstituierenden Elemente von Politik.
Um den Begriff „Regieren“ einzugrenzen, wird auf die Definition von Jachtenfuchs und Kohler-Koch zurückgegriffen, die Regieren „als den fortwährenden Prozess bewusster politischer Zielbestimmung und Eingriffe zur Gestaltung gesellschaftlicher Zustände“ beschreiben.
Aus der Synthese der beiden Forschungsfragen im Hinblick auf die zugrunde gelegten Definitionen der Begriffe „Integration“ und „Regieren“ ergibt sich die Leitfrage für die Studie:
Wie erfolgte Regieren im E(W)G-Institutionengefüge am Beispiel der Wettbewerbspolitik im Betrachtungszeitraum?
Zur Beantwortung dieser Leitfrage werden drei konzeptionelle Dimensionen des Begriffs „Regieren“ für die fünf ausgewählten Teilgebiete der E(W)G-Wettbewerbspolitik im Untersuchungszeitraum betrachtet, die sich an die Dreiteilung des Begriffs „Politik“ in der Politikfeld-Analyse anlehnt:
Strukturdimension: Diese umfasst normative und institutionelle, verfassungsmäßige Aspekte (Polity) des Regierens. Untersucht werden die sich herausbildenden Besonderheiten der Organisation, Verfahrensregelungen und Ordnung.
Prozessdimension: Diese umfasst die Prozesse der Willensbildung und Entscheidungsfindung des Regierens (Interessen, Konflikte) im Sinne der bewussten Setzung allgemein verbindlicher Handlungsziele und Maßnahmen zu deren Realisierung (Politics). Untersucht werden Macht, Konsens und Durchsetzung von Interessen und Zielen.
Inhaltliche Dimension: Gemeint sind der inhaltliche Aspekt von Politik (Policy). Untersucht werden erstens Ergebnisse und Entscheidungen über die zu bearbeitenden und diskutierten Inhalte, Aufgaben und Ziele von Politik. Zweitens sind konkrete Entscheidungen angesprochen. (...)
