Band 16: Integration von Infrastrukturen - Bd 2:Telekommunikation
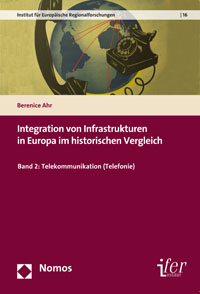
Berenice Ahr
Integration von Infrastrukturen in Europa im historischen Vergleich.
Bd 2: Telefommunikation (Telefonie),
Nomos 2013.
Inhaltsverzeichnis
Projektwebseite
Auszug aus der Einleitung:
Ein Ferngespräch von Deutschland ins benachbarte Ausland oder sogar nach Asien oder Amerika zu führen, ist heutzutage kein Problem mehr, der Teilnehmer braucht nur die gewünschte Nummer zu wählen, worauf das entsprechende Tonsignal bei freier Leitung den Verbindungsaufbau bestätigt. Das Intermezzo mit dem ‚Fräulein vom Amt’ gehört längst der Vergangenheit an, es gibt keine langen Anmelde- und Wartezeiten bis zum Zustandekommen des Gesprächs mehr, sondern alles funktioniert über die direkte Anwahl – und der Adressat oder seine elektronische Vertretung antworten. Die fernmündliche Nachrichtenübermittlung der heutigen Zeit bedeutet für den Nutzer, zu jeder Zeit und an fast jedem Ort mit der Welt vernetzt und erreichbar zu sein. Generell ist in der heutigen Zeit eine ausgeprägte, immer noch weiter zunehmende Vernetzung oder Verbindung in diversen Bereichen zu verzeichnen, die durch das Vorhandensein und reibungslose Funktionieren von Infrastrukturen ermöglicht wird. Besonders die modernen Kommunikationsmittel tragen dazu bei, dass Vernetzungs- bzw. Verbindungsmöglichkeiten – national wie international – in diesem Ausmaß vorhanden sind. Die intensive Nutzung der Telekommunikationsnetze und -dienste verdeutlicht, wie sehr die heutige Gesellschaft von der funktionsfähigen Infrastruktur abhängig ist und wie sehr sie sich tagtäglich auf genau diese Funktionsfähigkeit verlässt. Neben ihrer Verwendung im Alltag sind die modernen Telekommunikationsnetze und -dienste von grundlegender Bedeutung für die nationalen und internationalen Geschäfts- und Handelsverbindungen, da ein schneller Daten- und Informationsaustausch im globalen Wettbewerb unerlässlich ist. Die meisten Nutzer können sich ein Leben ohne Telekommunikation kaum mehr vorstellen und nehmen die internationalen Vernetzungs- und Verbindungsmöglichkeiten der Infrastruktur als selbstverständlich hin. Allerdings war diese Selbstverständlichkeit der unbeschränkten und grenzüberschreitenden Nutzungsmöglichkeiten nicht immer gegeben. Es ist demzufolge von Interesse nachzuvollziehen, welche Maßnahmen notwendig waren, um grenzüberschreitende Kommunikation zu ermöglichen, und wer an den Entwicklungen beteiligt war. Kurz gesagt geht es darum zu untersuchen, wie sich Integration im Telekommunikationsbereich vollzog und welche Merkmale sie aufwies. Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen des DFG-Projekts ‚Integration von Infrastrukturen in Europa vor dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg im Vergleich’ erstellt. Es handelt sich dabei um die Ergebnisse desjenigen Teilprojekts, das sich mit der Integration der drahtgebundenen Telekommunikation – in Abgrenzung zum drahtlosen Funkwesen – beschäftigte. Hinsichtlich der übergeordneten Fragestellungen, Zielsetzungen und methodischen Vorgehensweise orientiert sich das Teilprojekt an den für das Gesamtprojekt gültigen Vorgaben, niedergelegt im Projektantrag. Die in der Einleitung angeführten Inhalte orientieren sich diesbezüglich an dem DFG-Antrag unter Vornahme von Anpassungen bzw. Ergänzungen im Sinne der Erfordernisse des Teilprojekts.
Das Gesamtprojekt verfolgt als übergeordnetes Ziel, die Gemeinsamkeiten und/oder Unterschiede der Integration von Infrastrukturen in Europa in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg (seit den 1850er Jahren) mit der in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1970er Jahre herauszuarbeiten. Mit dem Begriff ‚Infrastruktur’ sind hier die Netze und die Dienste im Verkehrswesen (Eisenbahn, Binnenschifffahrt) und im Nachrichtenwesen (Post, Telekommunikation, Funk) gemeint. Unter ‚Infrastrukturintegration’ wird hier die Koordination von Infrastrukturnetzen und -diensten an den nationalen Außengrenzen (Interkonnektivität) sowie die Verschmelzung nationaler Infrastrukturnetze und -dienste (Interoperabilität) verstanden. Eine solche Interkonnektivität oder Interoperabilität wird durch die Vereinbarung neuer oder Angleichung bestehender technischer, betrieblicher, administrativer, tarifärer und rechtlicher Standards erreicht.
Auf der Basis einer vergleichenden Analyse der Ergebnisse aus den Teilprojekten sollen – nach Möglichkeit – spezifische Typologien von Infrastrukturintegration abstrahiert werden, die im Idealfall in einem Modell der Integration von Infrastrukturen münden. Der Fokus liegt daher in Bezug auf das Gesamtprojekt auf dem diachron-epochalen und synchron-sektoralen Vergleich der Integration von Infrastrukturen im Verkehrs- und im Nachrichtenwesen. Im Rahmen des Projekts werden dementsprechend die Strukturen der internationalen Beziehungen, die Prozesse der Willensbildung und Entscheidungsfindung innerhalb dieser Strukturen sowie die Inhalte der Standardisierung untersucht und herausgearbeitet, welche Wechselwirkungen zwischen Strukturen, Prozessen und Inhalten bestehen. Diachron-epochaler und synchron-sektoraler Vergleich werden dadurch ermöglicht, dass zum einen den Teilprojekten ein festes Raster von Vergleichskategorien vorgegeben und zum anderen eine Eingrenzung auf repräsentative Fallbeispiele für die Integration vorgenommen wird. Infolge des Ver- gleichs mehrerer Einzelstudien in diachron-epochaler wie synchron-sektoraler Hinsicht sollen schließlich generelle Aussagen getroffen werden.
