28. Juni 2017 Patrick Eiden-Offe (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin) Das Proletariat: soziale und literarische Figuration im VormärzIm Vormärz findet sich aus verarmten Handwerkern, städtischem Pöbel, vagierenden ländlichen Unterschichten, bankrotten Adligen und nicht zuletzt freigesetzten prekären Intellektuellen jene soziale Kollektivfigur zusammen, die in der Sprache der Zeit „das Proletariat“ genannt werden wird. Im Prozess der Figuration spielt Literatur eine doppelte Rolle: Zum einen bilden literarische Texte (und Texte von Literaten, die hier auch in anderer Funktion auftauchen können, etwa als Übersetzer oder Berater) – sociale Gedichte, Reportagen, Novellen, Pamphlete – einen wesentlichen Teil des Materials, aus dem die Sozialfigur des Proletariats sich bildet. Zum anderen folgt jener Bildungsprozess Verfahrensregeln, die selbst als literarische zu beschreiben sind: Das heterogene Material wird zusammengefasst und akzentuiert, ihm wird Kohärenz, Fasslichkeit und Nachvollziehbarkeit verliehen. Zugleich aber offenbart die Figur in ihrer Brüchigkeit auch einen prekären Charakter, der Rückschlüsse auf die sozialen Prozesse erlaubt, denen sich die Figuration verdankt. |
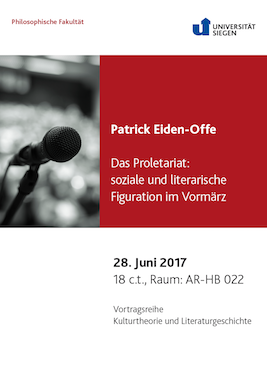
|
30. November 2016 Sabine Biebl (Universität Konstanz) ‚Dilettantismus‘ als Methode: Kulturgeschichte und Literatur im 19. JahrhundertEs war gerade ihre Nähe zu literarischen Darstellungsformen, nicht zuletzt ihr Hang zur Modegattung der Novelle, die der deutschsprachigen Kulturgeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert den Argwohn der universitären Fachgeschichte zuzog. Im leichtgängigen Erzählton, der poetisch-anschaulichen Beschreibung und konkretisierenden Fiktion, derer sich viele kulturhistorische Autoren bedienten, schien der Vorwurf des Dilettantismus, der mangelnden theoretischen und methodischen Reflexion seinen offenkundigen Beweis zu finden. Blieb der Kulturgeschichte in Deutschland damals somit die Aufnahme in die Geschichtswissenschaft weitgehend verwehrt, so erfreute sich ihre populäre Darstellung u.a. in den Werken Johannes Scherrs, Wilhelm Heinrich Riehls oder Gustav Freytags einer enormen Nachfrage ihrer bürgerlichen Leserschaft. – Der Vortrag fragt nach dem strukturellen Zusammenhang zwischen Literatur und Kulturgeschichte im Kontext der sozialen, politischen und kulturellen Umbrüche um 1850. Unterstellt wird ein ‚Dilettantismus‘ als Methode, in dem sich eine noch zu schreibende Geschichte der ‚kleinen Akteure‘ mit dem Möglichkeitsraum der Literatur zwingend verbindet. |
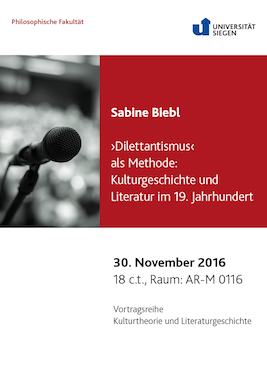
|
|
29. Juni 2016
Heide Volkening (Universität Greifswald)
Poetik und Politik: Funktionen des Charakters im Drama des 18. Jahrhunderts
Poetologische Debatten über die Form des Dramas und die Kategorie des Tragischen setzen im ausgehenden 18. Jahrhundert immer wieder bei der Darstellung des Charakters an. Lessings Mitleidskonzeption der Tragödie setzt auf den kohärenten Durchschnittscharakter, Schillers Pathetisches auf den heldenhaften, stoischen Charakter. Diese formalen Reflexionen sind gekoppelt an divergierende politische Entwürfe des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft – das Band der Empathie auf der einen, außer Kontrolle geratene Leidenschaften auf der anderen Seite. Form des Dramas und Konzepte des Politischen, so wird der Vortrag in Auseinandersetzung mit Lessing, Schiller und kontextualisierenden Diskursen zeigen, treffen sich in der Fokussierung auf den Charakter als gleichermaßen politische wie ästhetische Kategorie.
|
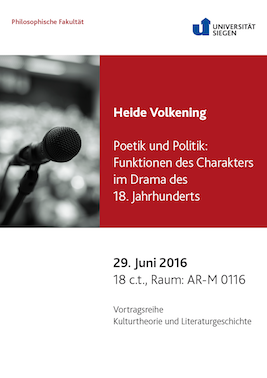
|
|
20. Januar 2016
Anne Baillot (Humboldt-Universität zu Berlin)
„Intellektuelle“ um 1800? Zur Operationalisierung einer kontroversen Kategorie
Mit der Zuschreibung „intellektuell“ wird eine Kategorie verwendet, die das Feld der Literaturwissenschaft zwangsläufig öffnet: „Intellektuelle“ können genauso gut Schriftsteller à la Voltaire, Sartre oder Zola sein wie Wissenschaftler à la Freud oder Einstein. Die öffentliche Stellungnahme erfolgt jeweils auf Grundlage des eingeworbenen geistigen Reputationskapitals. Für die Zeit um 1800 haben ohnehin disziplinäre Schubladen, die Schriftsteller von Wissenschaftlern trennen, nur einen geringen Operationalisierungswert: Chamisso ist Naturwissenschaftler, Weltreisender, Lyriker, Novellenschreiber; Tieck und A.W. Schlegel sind genauso praktisch wie theoretisch und historisch in der Literatur unterwegs. In der preußischen Hauptstadt sind im Kontext der napoleonischen Kriege geistige Tätigkeiten jeder Art – im literarischen wie im wissenschaftlichen Feld – mit politischen Überzeugungen eng verzahnt.
In der von der DFG zwischen 2010 und 2015 im Rahmen des Emmy Noether-Programms geförderten Nachwuchsgruppe „Berliner Intellektuelle 1800–1830“ ging es darum, den Erkenntniswert einer Begrifflichkeit auszuloten, die die Grenzgänge bewußt fokussiert. Nun: Was haben uns solche ideengeschichtlichen Ansätze über Texte zu sagen? Der Vortrag wird in diesem Sinne die fünf Jahre Projektarbeit des sechsköpfigen Teams bilanzieren.
|
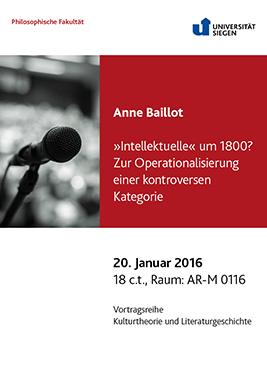
|
|
2. Juli 2015
Anna Kinder (Deutsches Literaturarchiv Marbach)
Big Archives: Zur Materialität von Großbeständen
Wie erforscht man 20.000 Aktenordner, wie findet man in 400 GB Datenmaterial, wonach man sucht? Archiv-Großbestände zeichnen sich nicht nur durch ihren Materialreichtum und ihre Materialheterogenität aus, sondern laden geradezu dazu ein, in den Modus der vorkritischen Materialbeschreibung zu verfallen. Die Unübersichtlichkeit von Großbeständen erfordert daher heuristische Strategien, die eine historisch-semantische Struktur freilegen, die auf der Oberfläche des Archivs nicht ohne Weiteres sichtbar ist. Ausgehend von der auch gegenwärtig zu beobachtenden Diskussion zwischen hermeneutisch interessierten, auf den literarischen Text fokussierenden Ansätzen auf der einen und materialitätsaffinen, an den Material Studies orientierten Herangehensweisen auf der anderen, wird die Frage nach dem Erkenntnisgegenstand literaturwissenschaftlich relevanter Großbestände gestellt.
|
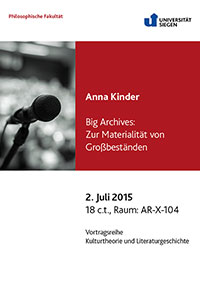
|