Millionen-Förderung für Smart Production Design Zentrum
Die Universität Siegen erhält für den Aufbau eines Smart Production Design Zentrums mehr als 3 Millionen Euro. An dem Zentrum sollen intelligente Werkzeuge entwickelt und erforscht werden, um den Wandel zur Industrie 4.0 aktiv mitzugestalten.

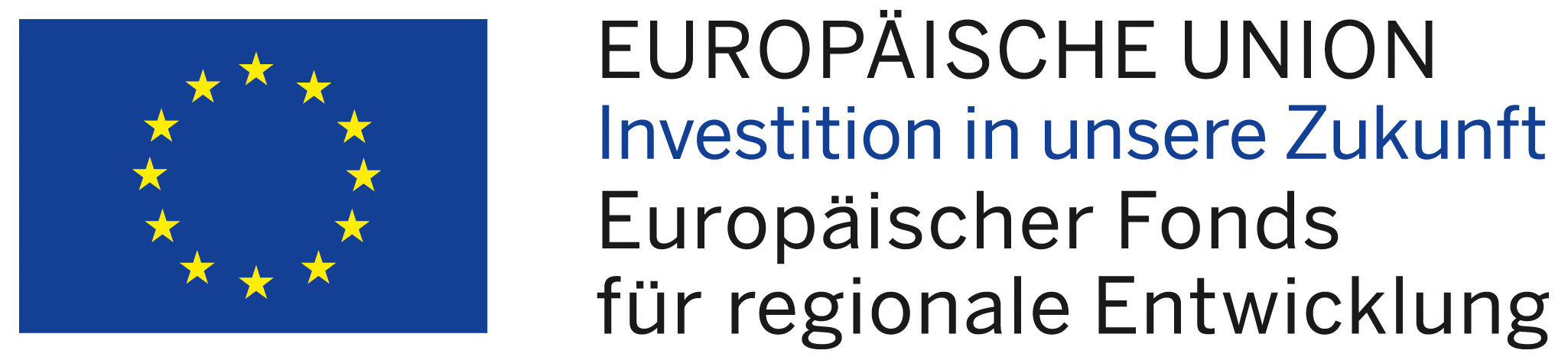
„Die Art und Weise, wie in der Industrie gearbeitet wird,
wird sich durch die Digitalisierung in den kommenden Jahren
grundlegend verändern“, sagt Projektleiter Prof. Dr. Bernd
Engel vom Lehrstuhl für Umformtechnik der Universität
Siegen. MitarbeiterInnen, die aus 7.000 Kilometern
Entfernung per virtueller Realität eine reale Maschine
reparieren oder Werkzeuge, die aus dem 3D-Drucker kommen
und sich selbstständig an Situationen anpassen – all das
könnte in Unternehmen künftig Wirklichkeit werden. Im Smart
Production Design Zentrum (Smap) sollen genau solche
intelligenten Werkzeuge und Methoden entwickelt und
erforscht werden. WissenschaftlerInnen von fünf
verschiedenen Lehrstühlen der Universität Siegen arbeiten
dazu eng zusammen. Das Land NRW hat für das Projekt jetzt
Fördermittel in Höhe von 3.060.207 Euro bewilligt. Das Geld
stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE).
„Wir freuen uns sehr über die Zusage. Das Smart Production
Design Zentrum ist ein Leuchtturmprojekt für den
Paradigmenwechsel im Werkzeugbau. Es wird die Sichtbarkeit
der Universität in unserer mittelständisch geprägten
Industrieregion deutlich erhöhen. Durch die Beteiligung von
Unternehmen aus ganz Deutschland hat es darüber hinaus eine
hohe Signalwirkung für den Wirtschaftsstandort NRW“, sagt
Prof. Dr. Peter Haring Bolívar, Prorektor für Forschung und
wissenschaftlichen Nachwuchs der Universität Siegen und mit
seinem Lehrstuhl direkt an dem Projekt beteiligt.
Die Forschung an dem neuen Zentrum soll drei Schwerpunkte
verfolgen, die alle miteinander verknüpft sind: Maschinen,
Werkzeuge und das Verhalten des Menschen. Zunächst möchten
die WissenschaftlerInnen gemeinsam mit den kooperierenden
Firmen neuartige Maschinen testen – etwa 3D-Metall-Drucker
oder –Scanner für den Werkzeugbau. In welchen Situationen
und für welche Produkte bringt der 3D-Drucker tatsächlich
einen Mehrwert? Und wie unterscheiden sich gefräste
Werkzeuge von solchen, die aus dem 3D-Drucker kommen?
In die Werkzeuge sollen außerdem neuartige, kabellose
Sensoren integriert werden. „Heute ist ein Werkzeug ein
bloßes Stück Stahl. Unsere Werkzeuge sollen Sensor und
Aktuator zugleich sein“, erklärt Prof. Engel. Das heißt:
Das Werkzeug meldet beim Arbeiten durch die Integration
modernster Sensoren jeden Fehler direkt zurück, verändert
gegebenenfalls seine Form oder Festigkeit, um sich auf die
neue Situation bestmöglich einzustellen und den Fehler zu
beheben, bevor er sich negativ auswirkt. Herkömmliche
Werkzeuge nutzen sich mit der Zeit ab, Fertigungstoleranzen
werden überschritten. Ein intelligentes Werkzeug soll das
verhindern.
Damit das funktioniert, müssen die ForscherInnen darüber
hinaus wissen, wie sich die Akteure, zum Beispiel die
WerkerInnen in der Fabrikhalle, verhalten. Welche
Bewegungen machen sie bei welchem Arbeitsschritt und wie
verhalten sie sich, wenn sie an einer Maschine arbeiten?
Die WissenschaftlerInnen haben eine große Vision für die
Zukunft: Sie möchten mit den intelligenten Werkzeugen den
Beruf des „Werkers 4.0“ erschaffen. Dieser könnte zuhause
oder im Büro sitzen, eine Virtual Reality-Brille tragen –
und sich damit in der virtuellen Realität einer Fabrik
bewegen, die in Wirklichkeit 7.000 Kilometer entfernt
liegt. Neben dem Abbild der Maschinen und den erfassten
Daten könnte er auch die Bewegungen der WerkerInnen vor Ort
beobachten und koordinieren, zum Beispiel um eine Maschine
zu reparieren. Wie bei einem Navi bekäme der ortsansässige
Werker die entsprechenden Anweisungen über den Experten und
hätte die Freiheit, diese umzusetzen oder eigene Vorschläge
zu machen, die dem Servicemitarbeiter direkt übermittelt
werden.
„Neben der enormen Geschwindigkeit der Servicetätigkeit und
den wegfallenden Reisetätigkeiten ergeben sich für
Lieferant und Kunden erhebliche Vorteile“ erklärt Prof.
Engel. „Wir wissen, dass das eine große Vision ist. Unsere
Forschung ist ein Mosaikstein in diese Richtung.“ Am Smart
Production Design Zentrum sollen neue Werkzeuge und
Methoden nicht nur entwickelt, sondern auch unmittelbar an
Industrie 4.0-Arbeitsplätzen getestet werden. Für kleine
und mittelständische Unternehmen besteht so die Chance, zu
einem frühen Zeitpunkt Einblicke in solche neuen
Technologien zu bekommen.
Hintergrund:
Am Smart Production Design Zentrum sind insgesamt fünf
Lehrstühle der Universität Siegen beteiligt:
- Prof. Dr. Bernd Engel, Lehrstuhl für Umformtechnik
- Prof.in Dr. Tamara Reinicke, Lehrstuhl für Produktentwicklung
- Prof. Dr. Martin Manns, Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Montage
- Prof. Dr. Volkmar Pipek, Lehrstuhl für Computergestützte Gruppenarbeit und soziale Medien
- Prof. Peter Haring Bolívar, Lehrstuhl für Höchstfrequenztechnik und Quantenelektronik
Das Projekt läuft zunächst bis Ende August 2022. Ziel ist
es zunächst, eine Forschungs-Infrastruktur aufzubauen, um
das Projekt danach in Kooperation mit der Industrie
fortzusetzen und eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen.
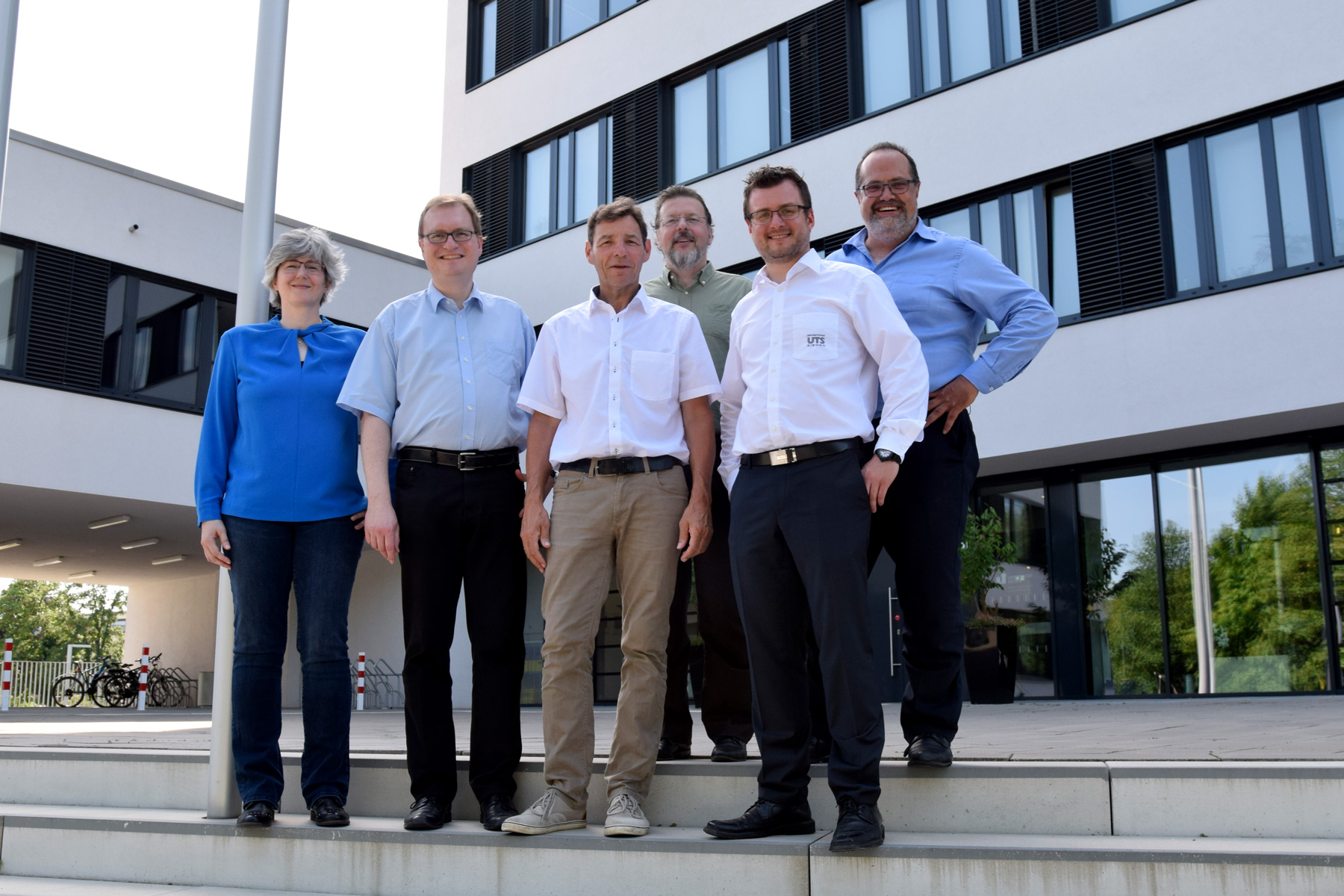
Interdisziplinäre Forschung (von links): Prof.in Dr. Tamara Reinicke, Prof. Dr. Martin Manns, Prof. Dr. Bernd Engel, Prof. Dr. Volkmar Pipek, Dr. Christopher Kuhnhen und Prof. Dr. Peter Haring Bolívar.



