Romseminar 2020
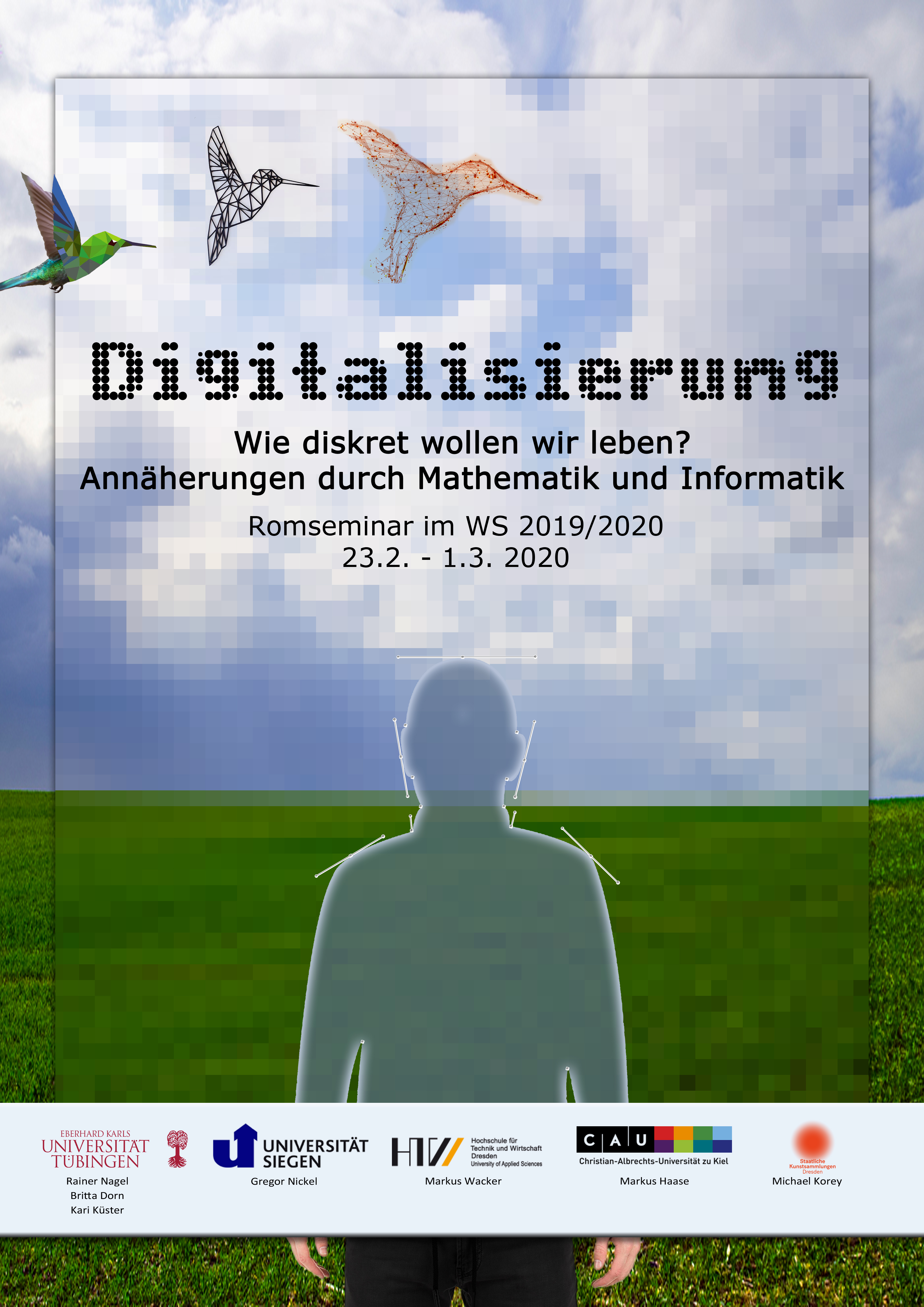
Romseminar 2020
Digitalisierung
Wie diskret wollen wir leben?
Annäherungen durch Mathematik und Informatik
“Computing machines are like the wizards in fairy
tales. They give you what you wish for, but do not tell
you what that wish should be.” Norbert Wiener
(1894–1964)
Das Schlagwort „Digitalisierung“ adressiert ein
komplexes Phänomen mit vielen Dimensionen, zumindest
einer wissenschaftlichen, einer technologischen, einer
politischen und einer im weiteren Sinne kulturellen.
Der Begriff des „Digitalen“ stammt dabei zunächst aus
dem Bereich der Nachrichtentechnik und bedeutet
lediglich, dass ein „digitales“ Signal (im Gegensatz
zum „analogen“) einen diskreten, also abgegrenzten und
gestuften Wertvorrat umfasst. Die Möglichkeit zur
Verarbeitung dieser „digitalen Daten“ durch
elektronische Rechenmaschinen gab dann einer ganzen
technologisch-kulturellen Revolution ihren Namen. Unter
Digitalisierung wird schließlich die durch den Einsatz
elektronischer Rechen- und Kommunikations-Mittel
vorangetriebene gesellschaftliche Umgestaltung
verstanden.
Das Romseminar 2020 wird sich dem Thema
„Digitalisierung“ auf zwei Ebenen widmen. Zum einen
sollen zentrale Begriffe bzw. Phänomene im Kontext der
Digitalisierung geklärt werden. Dies betrifft die
elementaren Begriffe: Daten, Zahlen, digital vs.
analog, Algorithmen, etc., aber auch technisch
anspruchsvollere Themen wie etwa ‛Big Data’,
‛Künstliche Intelligenz’, ‛Autonome Maschinen’. Hier
geht es also darum, die technische Seite der
Digitalisierung durch adäquate (!) Elementarisierung so
weit transparent zu machen, dass deren begriffliche
Voraussetzungen und technische Möglichkeiten beurteilt
werden können, ohne auf tendenziöse (teils
dystopisch-dramatisierende, teils euphorisch-werbende)
Interpretationen angewiesen zu sein.
Zum anderen geht es um einen vertieften Blick auf
ausgewählte gesellschaftliche Bereiche, die durch den
Prozess der Digitalisierung wesentlich umgestaltet
werden, wobei sich u.a. die Frage nach den Akteuren
bzw. der (anonymen?) Dynamik dieser Umgestaltung
stellt. Als Themen kommen hier unter anderem in
Frage:
- Der Bereich der Wissenschaften selbst: Inwiefern wird etwa in den Naturwissenschaften das Ziel, natürliche Systeme durch eine Analyse von bzw. Beschreibung durch Kausalbeziehungen zu verstehen, ersetzt durch die (automatisierte) Erhebung von riesigen Datenmengen und die anschließende Suche nach Korrelationen? In welcher Weise ändern aber auch klassische Geisteswissenschaften (etwa Literaturwissenschaften, Kunstgeschichte oder Archäologie) durch den Computer-Einsatz ihre Methodik in wesentlicher Weise und damit auch ihr Selbstverständnis? Und nicht zuletzt: wie weit prägt das Erheben von Daten und deren Auswertung (nach welchen Kriterien?) die Sozialwissenschaften?
- Im politischen (juristischen) Bereich können Fragen des Datenschutzes oder etwa die Transformation des Urheberrechts diskutiert werden.
- Brisanter ist vermutlich die Frage nach den extrem gewachsenen Erfassungs- und Kontroll-Möglichkeiten, wie dies private Unternehmen – Amazon und Google sind nur die bekanntesten – längst praktizieren. In diesen Bereich gehören wohl auch die neueren Entwicklungen zu einer Digitalisierung der sozialen Kontrolle etwa in China und anderen autoritären Staaten.
- Die Transformation der Arbeitswelt wird inzwischen viel diskutiert: welche Konsequenzen ergeben sich etwa für die weltweite, aber auch die lokale Wirtschaft, einzelne Unternehmen und Arbeitnehmer?
- Es ist nicht untypisch in der Geistesgeschichte, dass die jeweils avancierteste Technologie für das menschliche Selbstbild prägend wird (siehe die Hydraulik der Barock-Orgel oder die mechanischen Automaten der Uhrmacher). Welchen Einfluss hat also die Digital-Revolution auf das Menschenbild? Aber auch: Was bedeuten die konkreten, oder auch nur die ideologischen Perspektiven eines „Transhumanismus“?
- Was bedeutet es für das Erziehungssystem, wenn unter dem Schlagwort „Schulen an’s Netz“ eine verstärkte Orientierung der Schulpolitik an elektronischen Medien stattfindet?
- Schließlich kann auch die Erweiterung der Schlachtfelder des Militärs in die „virtuellen Welten“ und die Entwicklung „autonomer Kampfsysteme“ diskutiert werden.
Diese und weitere Themen will das Romseminar 2019
ansprechen und bietet damit die besondere Möglichkeit,
über den Tellerrand des eigenen Studienfachs hinaus zu
schauen. Daneben geht es auch darum, Präsentation,
Rhetorik und Diskussion zu üben.
Im Laufe des Wintersemesters werden wir uns zunächst
das Thema durch gemeinsame Lektüre, kleine
Impulsreferate und Diskussionen auf- und erschließen.
Bis Ende Dezember soll dann jeder Teilnehmer ein
eigenes Projekt gefunden und im Dialog mit den
Studierenden vor Ort erprobt haben. Dieses wird
schließlich während der Exkursionsphase in Rom (24. bis
29. Februar 2020) vorgestellt und diskutiert. Dabei
lassen wir uns durch ein vielfältiges Begleitprogramm
auch zu sonst nicht zugänglichen Orten dieser ‘Ewigen
Stadt’ inspirieren.
Voraussetzung für das Seminar ist Bereitschaft, sich
mit der Thematik engagiert auseinander zu setzen;
geeignet ab dem ersten Semester.
