Poetry@Rubens
Poetry@Rubens ist eine Lesungsreihe, veranstaltet von der Philosophischen Fakultät der Universität Siegen gemeinsam mit dem Apollo-Theater und dem Haus der Wissenschaft, die der Gegenwartsliteratur in der Stadt Siegen seit 2007 ein Forum bietet. Einmal im Jahr gibt es eine ausgewählte Lyrik-Lesung (Prof. Dr. Dieter Schönecker) und einmal pro Jahr eine Prosa-Lesung (Prof. Dr. Jörg Döring).
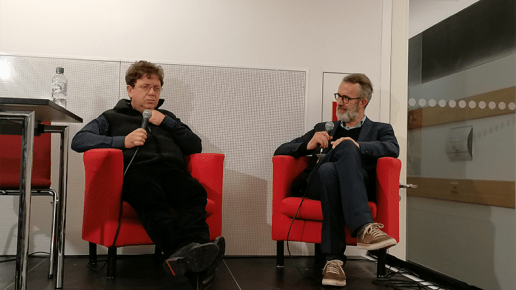
Poetry@Rubens
Michael Donhauser
"Unter dem Nussbaum" (18. November 2025)
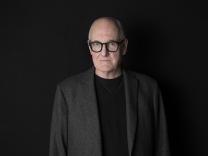
»Ein Aufhören, Aufrichten, ganz in Schwarz ein Atemzug Aufmerksamkeit« – mit diesen Worten setzte Michael
Donhauser vor nun fast vierzig Jahren an zum poetischen Flug, der bis heute nicht an Höhe, nicht an Verve und Versatilität verloren hat. Getragen von einem Wind, der den Rhythmus vorgibt, manchmal aufbraust, an den Bäumen, den Rosen rüttelt, dann wieder abklingt, gleich einem Atmen in allem, »wehend von fernher und feiernd«, erkundet Donhausers Dichtung seitdem die Welt mit jedem Vers ein Stückchen mehr, schaut um sich und lauscht, fächert sie auf und lässt sie sinnlich erfahrbar werden in einem allein der poetischen Wahrnehmung verpflichteten Werk. Einem Werk, das mit Unter dem Nussbaum bei Weitem keinen Abschluss findet, sondern sich mit Blick auf bereits Veröffentlichtes, Verstreutes, Verlorengeglaubtes in neuen Texten aufrichtet, anhebt, ein Schlagen mit den Flügeln, hin zu jenem Ort, wo sich zeigt, was Gedichte vermögen. (Verlag Matthes & Seitz Berlin) Moderation: Prof. Dr. Dieter Schönecker
Lena Schätte
"Das Schwarz unter den Händen meines Vaters" (11. November 2025)

»Motte« wird die Ich-Erzählerin von ihrem Vater genannt. Der Vater ist Arbeiter, Spieler, Trinker. Eigentlich hat Motte sogar zwei Väter: den einen, der schnell rennen kann, beim Spielen alle Verstecke kennt und sich auf alle Fragen eine Antwort ausdenkt. Und den anderen, der von der Werkshalle ins Büro versetzt wird, damit er sich nicht volltrunken die Hand absägt. Und das mit dem Alkohol, sagt die Mutter, war eigentlich bei allen Männern in der Familie so. Auch Motte trinkt längst mehr, als ihr gut tut. Schon als Kind hat sie beim Schützenfest Kellnerin gespielt und die Reste getrunken, bis ihr warm wurde. Jetzt, als junge Frau, schläft sie manchmal im Hausflur, weil sie mit dem Schlüssel nicht mehr das Schloss trifft. Ihr Freund stützt sie, aber der kann meistens selbst nicht mehr richtig stehen. (Verlag S. Fischer) Moderation: Prof. Dr. Jörg Döring
Armin Senser
"Topografien" (26. 11. 2024)
Weihnachten 2020
Ein leerer Raum. Halbdunkel. In der Ecke ein
Stuhl. Ein Bett. Ein Nachttisch. Ein Mann. Allein.
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt
sind, bin ich mitten unter ihnen. Weihnacht. Ein
leerer Raum. Nebel erhellt die Stadt. In der Ecke ein
Stuhl. Ein Mann. Allein. Wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten
unter ihnen. Ein leerer Raum. Weihnacht.
Halbdunkel. In der Ecke ein Stuhl. Ein Mann.
Allein. Ein Bett. Ein Nachttisch. Wo zwei in meinem
Namen versammelt sind, bin mitten unter ihnen.
Weihnacht. In der Ecke ein Stuhl. Ein Bett. Und
ein Mann. Allein.
Deniz Ohde
"Ich stelle mich schlafend" (05. 11. 2024)
Die Autorin Deniz Ohde war zu Gast bei Poetry@Rubens" im Apollo-Theater. Sie laß aus ihrem Roman „Ich stelle mich schlafend“. Moderation: Prof. Dr. Jörg Döring
Zum Inhalt: „Ich stelle mich schlafend“ erzählt von den dunklen Seiten einer Liebe – und die Geschichte einer Befreiung. Ein eindringlicher Roman über den Versuch einer Auslöschung und über die Frage, ob es eine Berührung gibt, die den Kern eines Menschen unwiederbringlich macht (Suhrkamp Verlag).
Am 26. November, 19 Uhr, Apollo-Theater, ist der Lyriker Armin Senser zu Gast. Er liest aus seinem neuen Gedichtband „Topographien“. Es geht dabei um eine Sammlung von Gedichten. Es gibt drei Kapitel: Tagebuch, Familienalbum und Topographien. Topographien sind Naturbetrachtungen. Das Familienalbum folgt Privatem. Und beim Tagebuch geht es um literarische Gattungen.
Dr. Christian Lehnert und Michael Symmons Roberts
"opus 8. Im Flechtwerk" und "Ransom" (22. 11. 2023)
Sieben mal acht Gedichtpaare bilden Im Flechtwerk, eine verwobene „Kunst der Fuge“. Musikalische Strukturen prägen die neuen Gedichte Christian Lehnerts. Die Verse vollziehen selbst nach, was sie erkunden: Gestaltwerdungen in der Natur. Sie entdecken, indem sie nachbilden, spüren auf, indem sie formen – und so geraten sie schöpferisch in eine natürliche Welt, die zu uns spricht. Die Gedichte unterwandern einen technisch-rationalen Naturzugang; ihr erster Impuls ist das Staunen über das Fremde. So ist der Same ein wiederkehrendes Motiv: In ihm ist – wie in der Sprache – eine Bedeutung verborgen, die sich als Pflanze entfaltet. Atmend wird in den Gedichten von Materie und Logos, von einem gespeichertes Wissen gesprochen, sei es als Laubwerk einer Linde, als Blaualge oder als hechelnde Hündin.
Ransom, von der Financial Times als Buch des Jahres 2021 ausgewählt, stellt die grundsätzliche Frage, was es bedeutet, Hoffnung zu schöpfen in einer gefallenen, verwundeten Welt. Die Gedichte in Ransom weisen die lyrische Schönheit und den metaphysischen Ehrgeiz auf, für die das Werk des Dichters Michael Symmons Roberts bekannt ist. Im Mittelpunkt dieses neuen Gedichtbandes stehen drei kraftvolle Sequenzen: eine im besetzten Paris, eine Elegie für seinen Vater und eine Meditation über Dankbarkeit. Die Gedichte bewegen sich an den Rändern des Glaubens und des Zweifels und arbeiten sich an mystischen und philosophischen Themen ab.
Christian Baron
"Schön ist die Nacht" (18. Oktober 2023)
Das Dröhnen und die Herrlichkeit, die Bürde und die Notwendigkeit des Lebens der „einfachen Leute“
Familien sind manchmal komplizierte Konstrukte. Das hat auch der Autor Christian Baron erfahren. Seine „sehr prekäre“ Kindheit in Kaiserslautern hat der Wahl-Berliner in zwei Büchern verarbeitet – „Ein Mann seiner Klasse“ und nun „Schön ist die Nacht“. Christian Baron war zu Gast bei Poetry@Rubens im Apollo-Theater. Er las aus "SChön ist die Nacht". Moderiert wurde die Lesung von Prof. Dr. Jörg Döring: „Baron hat seine eigene Geschichte aufgeschrieben“.
Die inkludiert den gewalttätigen Vater Ottes und die Mutter Mira, die unter Depressionen leidet und stirbt, als Christian Baron gerade einmal zehn Jahre alt ist. Die Kinder werden von der Tante aufgenommen. Diese Tatsache erweist sich als Glücksfall. Baron: „Sonst hätte ich kein Abitur gemacht, nicht studiert, wäre nicht Journalist geworden und hätte kein Buch geschrieben.“
Almut Sandig
"Leuchtende Schafe" (22. 11. 2022)
Ein ganz besonderer Lyrik-Abend erwartete die Gäste der Lesungs-Reihe „Poetry@Rubens“ im Apollo-Theater. Zu Gast war Ulrike Almut Sandig. Sie las aus ihrem neuen Gedichtband „Leuchtende Schafe“ und entführte dabei in vergangene wie auch in aktuelle und künftige Literatur-Welten. „Stellt Euch vor, Ihr sitzt in einem Filmtheater. Das Buch zieht und zieht und zieht Euch in den Film. Das Theater ist ein ganz schäbiges, altes Kino.“ Ulrike Almut Sandig bereitete ihr kleines Publikum mit Wortwitz, Stimmgewalt und Gesang auf eine Zeitenreise vor, die kombiniert war mit eigenen Botschaften der Jetzt-Zeit.
Die Basis des ersten Vortrags bildete der Stummfilm „Berlin, die Sinfonie der Großstadt“ von Walther Ruttmann aus dem Jahr 1926. Der Film wurde seinerzeit von den Kritikern wegen seiner hektischen Schnitte verrissen. „Wir haben eine Gegenwart mit hektischen Schnitten“, kommentierte Sandig. Heute ist die Hektik gegenwärtig. Im Berlin der 1920er Jahre mag das (noch) anders gewesen sein. Zum Schluss der Darbietung ein nachdenklicher, fragender Rückblick: „Was ist das für eine nicht zerbombte Stadt?“. 20 Jahre später hatte das völlig zerstörte Berlin ein anderes Aussehen.
Norbert Hummelt
"Sonnengesang" (03. 11. 2021)
Die Sonne und ihr Licht stehen im Mittelpunkt von Norbert Hummelts neuen Gedichten. Denn ganz gleich, wie kunstreich der Mensch seine Welt einrichtet, ohne das Sonnenlicht ist er verloren. Sie ist das künstliche Licht der Raumstation, die den Himmel über Berlin passiert. Die Kraft, die die Natur belegt, den Blick des Betrachters lenkt. Der Klang einer Glocke, den Ruf der Ringeltaube reißen ihn aus einer Starre, wecken Sehnsüchte, lassen Bilder aufsteigen, in denen Licht und Helligkeit gespeichert sind. Träume lassen sich nicht festhalten, außer in Versen - sie schwingen nach in den lebendigen Rhythmen dieser Gedichte, die einfach wie Lieder sind und doch voller Geheimnissse.
Weitere Autorinnen und Autoren in der Reihe Poetry@Rubens"
| 03.12.2019: Monika Rinck |
| 29.11.2018: Jan Koneffke |
| 25.04.2018: Andreas Maier |
| 09.11.2017: Carolin Callies |
| 09.03.2017: Sibylle Lewitscharoff |
| 09.11.2016: Jan Wagner |
| 14.01.2016: Nadja Küchenmeister |
| 20.10.2015: Ulla Hahn |
| 18.11.2014: Dirk von Petersdorff |
| 23.05.2013: Sara Khan |
| 01.02.2012: Diedrich Diederichsen |
| 16.01.2012: Roland E. Koch |
| 28.10.2010: Rainer Kirsch |
| 20.05.2010: Andreas Steinhöfel |
| 28.04.2010: Volker Braun |
| 2010: Wiglaf Droste |
| 18.12.2009: Kathrin Röggla |
| 29.05.2009: Angela Krauß |
| 06.02.2008: Sabine Gruber |
| 30.10.2007: Durs Grünbein |
Ansprechpartner

Univ.-Prof. Dr. Dieter Schönecker
- Professur Philosophie - Praktische Philosophie
- Vertrauensdozent des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit . Falls Sie den Eindruck haben, in Ihrer Wissenschaftsfreiheit beschränkt zu werden, können Sie sich per E-Mail an ihn wenden.
- interdisziplinäre Online - Diskussionsrunde zu dem Thema "Kant - Ein Rassist?"
- Appell für freie Debattenräume: www.idw-europe.org
Kontakt
Sprechstunde
Terminabsprache per E-Mail

Univ.-Prof. Dr. Jörg Döring
Kontakt
Sekretariat
Sprechzeiten
Bitte melden Sie sich an über Online-Sprechstundenanmeldung
INTERNATIONALPOETRY
Bilanz seit 2020
INTERNATIONALPOETRY
Jurij Andruchowitsch: "Lieblinge der Justiz“ (27. 05. 2020, online-Lesung, zugeschaltet aus der Ukraine)
Margaux und die BANDiten: Lyrik in unterschiedlichen Sprachen (23. 07. 2021, Pavillon am Oberen Schloss in Siegen)
Susin Nielsen und Anja Herre: „Optimists die first“ (19. 10. / 02. 11. 2021, online-Lesung und Workshop mit Studierenden)
Rosa Ribas: „Das Flüstern der Stadt“ (13. 05. 2022, Museum für Gegenwartskunst Siegen, im Rahmen 50 Jahre Universität Siegen)
Fernando Aramburu: „Die Mauersegler“ (04. 11. 2022, Haus der Wissenschaft Siegen)
Cristina Morales: „Leichte Sprache“ (26. 11. 2022, Kooperation mit der Romanistik der Uni Siegen, Martinikirche in Siegen)
Alois Hotschnig: „Der Silberfuchs meiner Mutter“ (05. 05. 2023, HDW der Uni Siegen)
Maddalena Fingerle: „Muttersprache“ (11. 11. 2023, Kooperation mit der Buchhandlung Hugendubel in Siegen)
Ansprechpartnerin

Dr. phil. Jana Mikota
Kontakt

Katja Knoche
Kontakt
