Samstags um 12
Lesungen von Autorinnen und Autoren, musikalische Leckerbissen, Diskussionen mit Pro und Kontra, Vorträge zu Themen aus der Wissenschaft – kunterbunt soll das Format „Samstags um 12“ am Campus Unteres Schloss (Foyer US - C) und US - S (Obergraben 25) sein.
Mitten im Herzen der Stadt und zur besten Siegener Marktzeit lädt das Haus der Wissenschaft alle Bürgerinnen und Bürger ein, das neue „Wohnzimmer“ der Universität mit Blick auf das Untere Schloss kennenzulernen und dabei selbst auf unterhaltsame Art hinzuzulernen.

Prof. Dr. Thomas Kaufmann
"Der Bauernkrieg. Ein Medienereignis" (13. 12. 2025)

Der Bauernkrieg stand im Fokus der letzten Veranstaltung von „Samstags um 12“ im Jahr 2025. Zu Gast war Prof. Dr. Thomas Kaufmann (Universität Göttingen). 2020 erhielt er den Leibniz-Preis. Er gehört zu den profundesten Kennern der Epoche der Reformation und der Frühen Neuzeit. Seine Forschungen und Publikationen zur Geschichte der Reformation, zu Martin Luther, den Täufern und zu der vor 500 Jahren die soziale, kulturelle und politische Welt grundlegend verändernden Medienrevolution, gelten als bahnbrechend. Bekannt ist Thomas Kaufmann auch aus der dreiteiligen „Terra X“ -Fernsehreihe „Der große Anfang – 500 Jahre Reformation“, die er als Fachberater begleitete, sowie aus der 20 Episoden umfassenden Fernsehproduktion „Die Deutschen“ von „Terra X“.
In Siegen hatte Kaufmann sein Sachbuch „Der Bauernkrieg. Ein Medienereignis“ dabei.
Zum Auftakt der Veranstaltung ertönte das Lied „Wir sind Geyers schwarzer Haufen“, das sowohl von den Nationalsozialisten als auch später in der DDR als politisches Kampflied genutzt wurde. Es entstand in den 1920er Jahren aus Reihen der Bündischen Jugend. Kaufmann: „Mit dem Bauernkrieg an sich hat es wenig zu tun.“
Das Interesse an der Beschäftigung mit dem Bauernkrieg blieb über 500 Jahre nicht zuletzt deshalb erhalten, weil er „umstritten erinnert“ wird, auch in den bis 1989 bestehenden beiden deutschen Staaten. Noch kurz vor dem Zusammenbruch der DDR wurde in Bad Frankenhausen ein riesiges Bauernkriegspanorama eröffnet. Es erinnert an die Schlacht vom 15. Mai 1525, in der die Bauern niedergemetzelt wurden und der Prediger Thomas Müntzer gefangen genommen und alsdann am 27. Mai 1525 in Mühlhausen hingerichtet wurde. Das Panorama steht unweit des Kyffhäuser, in dem gemäß der Sage Friedrich Barbarossa schläft. Kaufmann: „In die Erinnerung an den Bauernkrieg fließen diffuse Geschichtsströme zusammen.“
Friedrich Engels deutete den Bauernkrieg als „deutsche Revolution von 1525“. Diese sei aus ähnlichen Gründen gescheitert wie die Revolution von 1848, nämlich weil das Bürgertum damals die Bauern und nun das Proletariat sich selbst überlassen und verraten habe. Eine exponierte gesellschaftsgeschichtliche Rolle erkannte Engels vor allem Müntzer und den thüringischen Bauernaufstand zu. In Luther sah Engels den Anwalt des bürgerlich-aristokratischen Lagers. Engels Blick auf den Bauernkrieg war prägend für die Geschichtsschreibung der DDR, wobei, so Kaufmann, die Aufständischen sich keinesfalls als „deutsch“ im Sinne eines nationalistischen Narrativs gesehen hätten.
Kaufmanns Herangehensweise an den Bauernkrieg ist anders. „Ich denke, der Bauernkrieg ist medial initiiert worden.“ Und weiter: „Er war das erste medial flankierte militärische Großereignis der europäischen Geschichte“. Eine Rolle spielten seit etwa 1500 so genannte Prognostiken. Aufruhr und Revolten der Bauern wurden auf Basis der Himmelskonstellationen für 1524 vorhergesagt. Thomas Morus‘ „Utopia“ war 1516 erschienen. Die Reformatio Sigismundi ging davon aus, dass kein Christenmensch Leibeigener sein darf. Die wirkungsreichste Publikation des Bauernkriegs waren die „Zwölf Artikel“, für die evangelische Bürger Memmingens verantwortlich zeichneten. Publiziert wurden diese in der Druckmetropole Augsburg. Ziel war, die soziale und ökonomische Situation der Bauern zu verbessern. Als Argumentationsgrundlage diente die Bibel. Die Memminger Bundesordnung ist ein konkurrierendes Druckwerk, das in zwei Druckfassungen erschien und nicht zuletzt darlegt, wie mit Konfliktsituationen umzugehen ist.
Im 19. Jahrhundert, so Kaufmann, versuchte die Geschichtsschreibung dem Bauernkrieg einen Sinn zu geben. Grundlegend war, dass „Adelige und Städter dabei über Bauern sprachen“. Im Zuge der politischen Inanspruchnahme des Bauernkriegs wurden nun ,Helden‘ kreiert. Thomas Müntzer ist dabei der einzige ,Held‘ des Bauernkriegs, der seinen Status zeitgenössischer publizistischer Aufmerksamkeit verdankt. Sie war vor allem der vernichtenden Polemik Martin Luthers und der Seinen geschuldet. Durch die Sichtweise von Engels wurde Müntzer zum Helden kommunistischer Ideale.
Stephanie Neigel und Hanno Busch
Siegener Nacht der Musik (15. 11. 2025)

Stephanie Neigel und Hanno Busch präsentierten Jazz vom Feinsten
Aus dem Format „Musik um 12“ wurde am 15. November einmalig „Musik um 20 Uhr“. Grund war die Teilhabe der Universität Siegen am Programm der „Siegener Nacht der Musik“. Im Foyer des Hörsaalzentrums Unteres Schloss gab es Jazz vom Feinsten. Die Jazz- und Popsängerin Stephanie Neigel präsentierte bei ihrem Antrittskonzert in Siegen gemeinsam mit dem Jazz-Gitarristen Hanno Busch Selbst-Komponiertes und Bestandswerke. Im Dämmerlicht wusste die neue Dozentin für Jazz, Rock und Pop ihr Publikum zu begeistern.
Wegen der Begrenzung der Personenzahl im Foyer wurden an der Eingangstür Tickets ausgegeben. Zwischenzeitlich bildete sich eine lange Schlange, um nach und nach Einlass, zum Konzertort zu erlangen.
Stephanie Neigel sang vor allem Stücke aus ihrem Album „Phallée & Baldu – Zwischen den Zeilen“. Ihr Texte entstehen häufig aus alltäglichen Erlebnissen, wie einer schlaflosen Nacht, „in der jedes Geräusch (Miauen der Katze, Ticken der Uhr, Geräusch eines vorbeifahrenden Motorrads) vom Einschlafen abhält“. Der Songtitel lautet „Dance with the devil“. Die von der Songwriter-Ballade bis zum fast exotisch temperierten Uptempo und manchmal bis in den Jazz reichenden Songs, sagt Neigel, habe sie „so nicht detailliert geplant. Ich hatte Lust, verschiedene Sachen auszuprobieren, auch von einer konventionellen Besetzung wegzugehen.“
Mit donnerndem Applaus und natürlich nur mit einer Zugabe wurden Stephanie Neigel und Hanno Busch in den späten Feierabend verabschiedet.
Dr. Christian Spiering
"Das seltsamste Teilchen der Welt. Auf der Jagd nach dem Neutrino" (25. 10. 2025)
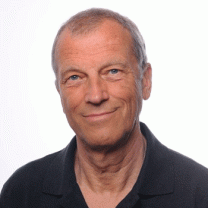
„Samstags um 12“ startete am 25. Oktober 2025 ins Wintersemester. Zu Gast war der Physiker Dr. Christian Spiering vom DESY in Zeuthen. Spiering hatte sein dann soeben erschienenes Sachbuch dabei – „Das seltsamste Teilchen der Welt. Auf der Jagd nach dem Neutrino“ (12.00 Uhr, US – S 002, Obergraben 25, Siegen). Eine bestohlene Physikerin und ein verschwundener Forscher: Der Elementarteilchenphysiker erzählte anhand von sieben Portraits durch die Zeit, die Jagd nach dem Neutrino.
Während Sie diesen Text lesen, fliegen unbemerkt Billionen Neutrinos durch Ihren Körper. Die „Geisterteilchen“ sind ein Schlüssel zum Verständnis des Universums. Wie aber fängt man etwas ein, das sich nicht fangen lassen will? Christian Spiering ist ein international renommierter Neutrinoforscher. Hier erzählte er die spannende Geschichte einer seit 100 Jahren andauernden Jagd, die Forscherinnen und Forscher an den Südpol, tief unter die Erde, zwischen die Fronten des Kalten Krieges und nicht selten an den Rand der Verzweiflung geführt hat – von Lise Meitner über Wolfgang Pauli bis mitten hinein in die Gegenwart. Verständlich und spannend wie ein Wissenschaftskrimi (Verlag Hanser).
Aus „Musik um 12“ wird am 15. November einmalig „ Musik um 8“. Das Haus der Wissenschaft reiht sich in die Siegener Nacht der Musik ein. Jazzgesang mit Stephanie Neigel gibt es ab 20 Uhr im Foyer des Hörsaalzentrums am Campus Unteres Schloss. Die Multi-Instrumentalistin Stephanie Neigel musiziert aus ihrem neuesten Werk, dem Duo-Album „Phalleé & Baldu“, in dem sie mit ihrem Künstlernamen agiert und das Art-Pop-Universum mal eben neue vermisst. Begleitet wird sie dabei von Hanno Busch, der seit 2024 Professor für Jazzgitarre an der HfMT Köln ist und international zu den gefragtesten Gitarristen seiner Zeit gehört. Neigel wird ebenfalls an der Gitarre und auch am Klavier selbst zu hören sein. Ihre handgemachte Musik zwischen Jazz und Pop reißt mit, hat schlaue Texte, sie grooven, sie improvisieren, es wird gelacht und geweint – gute Musik, nicht mehr und nicht weniger.
Das Jahr 2025 steht (auch) im Zeichen der Erinnerung an den Bauernkrieg von 1525. Nicht zuletzt im thüringischen Mühlhausen widmet sich eine Landesausstellung dieser Thematik. Zu deren Beratern gehört der Göttinger Kirchen-Historiker Prof. Dr. Thomas Kaufmann. Der Leibniz-Preisträger verfasste zudem ein Sachbuch zum Thema „Der Bauernkrieg. Eine Mediengeschichte“. Kaufmann ist am 13. Dezember 2025 (US - S 002, Obergraben 25 in Siegen) zu Gast bei "Wissenschaft um 12".
Zum Inhalt: Der Bauernkrieg bildet neben der Reformation die Schwelle zur Neuzeit. Anders als die Reformatoren aber können seine Protagonisten ihre teilweise modern klingenden Forderungen nicht durchsetzen. Die Erhebung der Bauern wird blutig niedergeschlagen. Der Bauernkrieg wurde immer auch ideologisch interpretiert – schon zeitgenössisch war er – so Kaufmann – vor allem ein Medienereignis. Durch umfassende Quellenstudien entlarvt Kaufmann ideologische Verzerrungen und präsentiert eine fesselnde Neuinterpretation dieses bedeutenden Ereignisses. Mit Leidenschaft und Expertise öffnet er einen völlig neuen Blick auf den Bauernkrieg. So wird deutlich: Der Bauernkrieg war nicht nur ein Kampf um soziale Gerechtigkeit, sondern auch ein Kampf um die Deutungshoheit. (Verlag Herder)
Vermutlich im Januar 2026 wird „Musik um 12“ mit Lena Maria Kramer nachgeholt. Präsentiert wird eine kleine musikalische Weltreise: Lieder und Arien von Otto Nicolai, Carlisle Floyd, Leonard Bernstein…. Der genaue Samstags-Termin wird zeitnah bekanntgegeben.
Prof. Dr. Manfred Hildermeier
"Die rückständige Großmacht. Russland und der Westen" (05. 07. 2025)
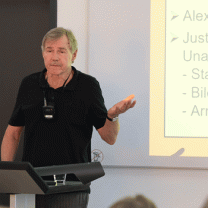
Ist Rückständigkeit ein Schimpfwort, oder der nüchterne Befund eines Entwicklungsstadiums? Birgt Rückständigkeit die Chance auf Entwicklung auf der Basis getesteter Innovation, oder ist sie Zeugnis eigener Innovationsunfähigkeit? Zumindest birgt der Begriff der Rückständigkeit Diskussionspotenzial. Das erlebten die rund 90 Gäste bei „Wissenschaft um 12“ zum Thema des Buches von Prof. Dr. Manfred Hildermeier „Die rückständige Großmacht. Russland und der Westen“.
Der Göttinger Osteuropa-Historiker lud auf eine Wissensreise durch 1000 Jahre russischer Geschichte ein. Der Begriff der Rückständigkeit wurde in Russland bereits früh von politischen und sozialen Eliten geprägt. Hildermeier: „Das Bewusstsein der eigenen Rückständigkeit überwiegt bis in die heutige Zeit.“ Bereits im 15. Jahrhundert, zu Zeiten des Moskauer Metropoliten Isidor, deutet die Beschreibung einer Reise durch den Westen in diese Richtung. Im Vergleich beispielsweise zur westlichen Bauweise, Technik und Medizin wurde Russland als unterlegen erachtet. Hildermeier: „Diese Sichtweise bildete den Grundton der nächsten drei Jahrhunderte.“ Dabei fühlte sich die Kiewer Rus' nicht zuletzt auf der Basis vielfältiger Ehearrangements als zwar am Rande des Westens liegend, aber doch zugehörig. Erst das Schisma von 1054 ließ die Kontakte ob der religiösen Differenzen abbrechen und eröffnete eine Kluft zwischen Ost(Kirche) und West(Kirche). 1453 fiel Konstantinopel an die Osmanen. Das eröffnete rund eineinhalb Jahrhunderte später die Basis für die Translatio Imperio „Moskau das 3. Rom“.
Mitte des 16. Jahrhunderts begann Zar Ivan IV. mit der Anwerbung von Handwerkern aus dem „Westen“, vor allem aus Deutschland. Sein Nachfolger Boris Godunov wie auch der erste Romanov-Zar Michael setzen diese Bestrebungen fort. Peter der Große gilt als Begründer einer starken Westorientierung. Hildermeier: „Er stieß das Fenster zu Europa besonders weit auf.“ Unter Katharina der Großen erwuchs ein neuer Typus des russischen Adeligen: die Erziehung übernahmen Lehrer aus dem Westen; die jungen Adeligen gingen auf Kavalierstour durch Europa. Hildermeier: „Der russische Adel wurde so, wie Peter der Große sich das gewünscht hätte.“ Eine riesige Kluft zwischen der Entwicklung in der Stadt und dem Land blieb bestehen.
Der Invasion Russlands durch Napoleon folgte zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Rückbesinnung auf die russische Kultur und russische Werte. Ein antiwestlicher Konservativismus russischer Prägung, bestehend aus der Dreieinigkeit aus Autokratie, Orthodoxie und Nationalbewusstsein, entstand. Hildermeier: „Das Zarenreich wurde zum Gendarmen Europas.“ Eine Geheimpolizei wurde installiert. Dennoch, so Hildermeier, gab es auch gegenläufige Bewegungen. Ein Bildungssystem nach preußischem Vorbild wurde aufgebaut; die Industrie entwickelte sich auch mit bäuerlichen Arbeitnehmern, Beamte wurden erstmals an Universitäten ausgebildet – Qualifikation dominierte Herkunft. Die Niederlage Russlands im Krimkrieg (1853-56) stieß weitere Entwicklungen vor allem mit Blick auf Waffentechnik und Armee an. Westliche Investitionen in Russland stiegen an.
Der bolschewistische Umsturz 1917 sollte ein Gegenentwurf zum westlichen Kapitalismus sein. Zum ideologischen Hauptgegner avancierten die USA. Dennoch wurden die Vereinigten Staaten und vor allem der Unternehmer Ford verehrt. Hildermeier: „Der russische Marxismus basierte auf einer Technologisierungs-Ideologie. Das Land sollte modernisiert werden.“ Stalin führte die Zentrale Planwirtschaft ein: „Die Überfüllung der Pläne rechtfertigte jeden Terror.“ Zweieinhalb Fünfjahrespläne bildeten das Fundament einer modernen Industrie. Hildermeier: „Treibende Kraft war der Staat. Das technische Wissen und moderne Maschinen lieferte der kapitalistische Westen.“
Der Kalte Krieg beendete diese Kooperation. Aus dem besiegten Deutschland deinstallierte Industrien und deportierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führten nicht dazu, dass die Sowjetunion beispielsweise mit dem deutschen Wirtschaftswunder Schritt halten konnte. Zwei Kernanforderungen kristallisierten sich in der Sowjetunion heraus: die Schaffung von Wohnraum und die Versorgung der Bevölkerung mit Autos. In den 1960er Jahren entstanden über 12 Millionen kleine Privatwohnungen, die für eine städtische Mittelschicht erschwinglich waren. Unter Breschnew gab es eine Art Gesellschaftsvertrag: keine Mitsprache, aber mehr Wohlstand. Der „Wolga“ als FIAT-Ableger wurde ebenfalls für die Mittelschicht bezahlbar.
Mit dem Ende der UdSSR zu Beginn der 1990er Jahre entwickelte sich Vieles aus Sicht der Bevölkerung zum Schlechten. Jelzin stürzte das Land ins wirtschaftliche Chaos mit hoher Korruption und Kriminalität. Diese Zeit gebar die Oligarchen. Hildermeier: „Diese Situation hat Putin ins Amt gehoben.“ Der Boom der Erdölpreise führte zur „goldenen Zeit“ der anfänglichen 2000er Jahre: „Russland lernte unsicher und ungeschickt ein reiches Land zu sein“. Das Ende kam mit der Weltwirtschaftskrise 2008. Auch im Jahr 2014/15 zur Zeit der Krim-Annexion „dümpelte die russische Wirtschaft vor sich hin“. Die Industrie wurde nicht modernisiert; viel Geld floss in die Aufrüstung der Armee. Der Export heimischer Naturschätze finanzierte den Import westlicher Waren.
Ohne die konsequente Umsetzung der gegen Russland verhängten Embargos, so die Einschätzung Hildermeiers, könne Putin den 2022 begonnenen Krieg gegen die Ukraine noch jahrelang fortsetzen. Und: „Keine Oligarchen-Yacht wurde jemals in Russland gebaut.“
Prof.in Dr. Martina Heßler
"Sisyphos im Maschinenraum. Eine Geschichte der Fehlbarkeit von Mensch und Technologie" (31. 05. 2025)

„Wie formt Technik Gesellschaft?“ – Diese Eingangsfrage von Moderator Prof. Dr. Ralph Dreher (Technikdidaktik an der Uni Siegen) setzte bei „Wissenschaft um 12“ den Rahmen einer gut zweistündigen Veranstaltung. Zu Gast war die Technikhistorikerin Prof.in Dr. Martina Heßler von der TU Darmstadt. Ihr vor wenigen Wochen erschienenes Buch „Sisyphos im Maschinenraum. Eine Geschichte der Fehlbarkeit von Mensch und Technologie“ ist für den Deutschen Sachbuchpreis 2025 nominiert. Seit der Industrialisierung gebe es den Stereotypen, Maschinen funktionierten besser als Menschen, so Martina Heßler.
Der Technikchauvinismus werte den Menschen im Vergleich zur Maschine systematisch ab. Diese Einstellung stelle eine Grundfiguration der westlichen Moderne dar. Der fehlerhafte Mensch führe zur Folgerung, dieser müsse durch Maschinen ersetzt werden. Autonomes Fahren werde apostrophiert, um menschliches Versagen zu beseitigen. Autonome Drohnen töteten „ethischer“ als Menschen. Empfangsroboter in Hotels hätten bessere Manieren als Menschen….. Martina Heßler: „Ich untersuche die Figur des fehlerhaften Menschen als Stereotyp in unterschiedlichen Lebensbereichen. Seit über 200 Jahren wiederholen sich die Argumente.“
Die Figur wurde im frühen 19. Jahrhundert etabliert. Die Autorin verdichtet in ihrem Buch Argumente und ist sich bewusst, dass ihre Darstellungen nicht immer objektiv sind. Konsequenzen des Stereotypen sind a) die Überzeugung, Menschen seien überfordert, b) eine Zunahme technologischer Fehler und c) eine stete Steigerung der Technologie, um Fehler zu korrigieren – eben Sisyphos. Durch eine immer komplexere Technologie, die auch immer fehleranfälliger werde, erschienen der Berg des Sisyphos immer höher und steiler, der Stein immer schwerer und größer. Während ihrer Recherchearbeit fühlte sich die Autorin mehrfach an das stetig wachsende Bürokratiesystem in Deutschland erinnert.
Mit Blick auf die Fabriken betonte der schottische Mediziner und Naturwissenschaftler Andrew Ure 1895 die Schwäche der menschlichen Natur und die menschliche Fehlbarkeit. Menschen seien sündig, fehlbar, unvollkommen und hätten körperliche Schwächen. 1974 sei in einer VDI-Zeitschrift eine Liste der menschlichen Unzulänglichkeiten erschienen: Langsamkeit, Unregelmäßigkeit, mangelnde Präzision, Hang zu schlecht geordnetem Wissen, langsames Lernen bis hin zur Kritikunfähigkeit… Die Ausschaltung der menschlichen Fehler sei gleichzusetzen mit der Ausschaltung des Menschen in der Fabrik. 2016 sei im Rahmen des US-Wahlkampf die Idee aufgekommen, einen Computer als geeigneteren Kandidaten aufzustellen – „Watson for President“.
In den 1950er Jahren herrschte Angst vor einem Atomkrieg und vor allem davor, dass Menschen irrational und emotional entscheiden und eine solche Auseinandersetzung auslösen könnten. Als Lösung wurde der Computer betrachtet, der besser denken könne als Menschen. Der Maschine werde folgendes Idealbild zugedacht: präzise, schnell, gleichmäßig, regelmäßig, zuverlässig, berechenbar, planbar, objektiv, rational, Regeln einhaltend. Dass es am 26. September 1983 nicht zu einem atomaren Gegenschlag der Sowjetunion gegen die NATO kam, ist dem sowjetischen Oberstleutnant Stanislaw Petrow und seiner Entscheidung zu verdanken, einem Fehlalarm des Frühwarnsystems nicht zu vertrauen. Der Fehlalarm war durch Sonnenreflexionen an Wolken ausgelöst worden.
Das Sicherheitsbedürfnis der fehlerhaften Menschen ist hoch. Beim Autofahren soll die Schrecksekunde durch ABS umgangen werden. Kam der Computer gerade also zur rechten Zeit? Wenn ja, wofür? Die Spirale von Fehler, Fehlerbehebung, Technik und immer komplexerer Technik dreht sich weiter. Dabei, so Heßler, könnten manche Probleme durchaus mit Verhaltensveränderungen von Menschen behoben werden. So seien Autos bei niedriger Geschwindigkeit besser beherrschbar als bei hoher. Weniger Autoverkehr komme der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zugute. Diese Beschränkung würde dem steten Höher und Weiter zumindest punktuell Grenzen setzen. Dem Vortrag von Prof.in Martina Heßler folgte eine etwa einstündige, intensive und spannende Diskussion.
Mirko Drotschmann
"Fake News - Eine Gefahr für die Demokratie?" (24. 05. 2025)
„Fakt oder Fake?“ – diese Frage stand bei den Angebten des Hauses der Wissenschaft im Rahmen der Offenen
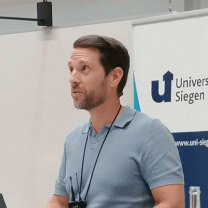
Uni auf dem Hof des Unteren Schlosses in Siegen im Fokus. Moderator und YouTuber Mirko Drotschmann weitete den Blick der rund 600 überwiegend jungen Besucherinnen und Besuchern im Schadeberg-Hörsaal für das Thema Fake News. Er veranschaulichte, wie Meldungen und Fotos auf Glaubwürdigkeit und Herkunft geprüft werden können. Mehrfach donnernder Applaus war ihm zum Abschluss ebenso gewiss wie eine lange Fan-Reihe beim Warten auf Selfies.
Das Rätsel des HDW „Fakt oder Fake?“ wurde von etlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelöst. Fünf von Ihnen erhalten das Kartenspiel „Siegerlandquiz“ als Gewinn. Zur Auflösung: 1) Napoleon Bonaparte hat im Rahmen seines Ägyptenfeldzugs nicht den Befehl geben können, der Sphinx die Nase wegzuschießen, da bereits eine im Jahr 1755 von Frederic Louis Norden veröffentlichte Skizze die Sphinx ohne Nase zeigt. Napoleon wurde erst 1769 geboren. 2) Thomas Edison erfand 1879 die erste Kohlefaden-Lampe, die mehrere Tage brannte. Dafür verbesserte er die Erfindungen anderer. 3) Der berühmte Teppich von Bayeux in der Normandie ist eine Stickerei. Szenen aus der Schlacht von Hastings (1066) werden als Stickarbeiten erzählt. 4) Der Zeitraum vom Bau der Pyramiden von Gizeh bis zur Geburt von Kleopatra (ca. 2530 Jahre) ist länger als der Zeitraum zwischen der Geburt Kleopatras und der Erfindung des iPhones (ca. 2075 Jahre). 5) Peter Paul Rubens wurde in einem nicht mehr existierenden Haus auf dem heutigen Areal der Realschule am Oberen Schloss geboren. Eine Plakette auf dem Schlosshof erinnert daran. 6) Haben Giraffen, Menschen und Mäuse alle gleich viele Halswirbel? Ja. Die meisten Säuger haben sieben Halswirbel. 8) Die Sonne ist der Zentralstern des Sonnensystems. Da sie 99,86 % der Gesamtmasse des Systems hat, ist sie sehr nahe dem Baryzentrum des Sonnensystems. In der Reihenfolge ihres Abstands von der Sonne folgen die terrestrischen Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars, die den inneren Teil des Planetensystems ausmachen.
Prof. Dr. Martin Melles
"Wie stabil ist der Eisschild der Antarktis gegenüber dem Klimawandel" (14. 12. 2024)

Die Antarktis ist mit einer Fläche von 14.200.00 km2 rund 40 Prozent größer als Europa. Die Temperatur in der Antarktis bewegt sich zwischen - 5 und – 70 °C. Erhebungen erreichen eine Höhe von bis zu 4000 m. Bei der Antarktis handelt es sich um eine Kältewüste mit 50 – 300 mm Niederschlag im Jahr. Für das Weltklima hat die Antarktis ganz besondere Bedeutung. 90 Prozent der Eisflächen sind auf Grönland und der Antarktis zu finden. Die Gletscher der Welt umfassen insgesamt nur etwa 1 Prozent der weltweiten Eisflächen. „Wie stabil ist der Eisschild der Antarktis gegenüber dem Klimawandel?“ lautete das Thema des Geologen Prof. Dr. Martin Melles (Universität zu Köln) im Rahmen der Weihnachtslesung „Wissenschaft um 12“.
Rund 80 Gäste aus nah und fern lauschten dem Vortrag, dem sich etliche Fragen anschlossen. Prof. Melles erläuterte, dass – sollte das Eis der Antarktis schmelzen – der Meeresspiegel um bis zu 63 m ansteigen würde. Die Stadt Siegen bekäme dann Strandlage, die Stadt Köln würde unter Wasser liegen. Melles: „Die Welt würde sich massiv verändern.“ Das Eis reagiere allerdings sehr träge. Zum Ende dieses Jahrhunderts sei ein Anstieg des Meeresspiegels um mehr als 20 cm möglich. Bei einem Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter müssten etwa 630 Millionen Menschen ihre angestammte Heimat verlassen.
Seit 1880 wird die Lufttemperatur kontinuierlich aufgezeichnet. Seit den 1980er Jahren steigt diese stetig an mit der Auswirkung, dass die Gletscher schwinden. Auch auf Grönland verstärken sich die Schmelzprozesse. Die Temperaturen in der Antarktis liegen weiterhin im Minusbereich. Die Lufttemperatur kann deshalb nicht dafür verantwortlich sein, dass in bestimmten Bereichen das Eis schmilzt. In anderen Bereichen nimmt das Eis zu. Grund für den Schmelzprozess ist wahrscheinlich das zirkumpolare Tiefenwasser, das das Schelfeis (große Eisplatte, die auf dem Meer schwimmt) tauen lässt. Das zirkumpolare Tiefenwasser ist einer von drei Hauptströmen, die im Südpolarmeer um die Antarktis auftreten. Als Ausgleich für das antarktische Bodenwasser und das antarktische Oberflächenwasser, die beide (kaltes) Wasser aus dem Bereich der Antarktis hinausführen, besteht das zirkumpolare Tiefenwasser aus wärmerem Wasser, das aus den das Südpolarmeer umgebenden Ozeanen – insbesondere dem Nordatlantik – in Richtung Antarktis fließt. Melles: „Wir wissen noch nicht ganz genau, warum das Eis schmilzt oder wächst.“
Ein Blick auf die Erdgeschichte zeigt, dass sich die Erde in den zurückliegenden 4,6 Milliarden Jahren stets im Wandel befand. Über lange Zeit hinweg war die CO2-Konzentration derart hoch, dass Leben unmöglich war. Melles: „Wir leben heute eigentlich in einem Eishaus, das durch uns Menschen verändert wird.“ Will heißen: Die Erde befindet sich aktuell in einer beginnenden Kaltzeit. Mit Blick auf den Klimawandel könnte diese Entwicklung dem Leben auf der Erde zugutekommen. Melles: „Problematisch könnte aber das Tempo der Erwärmung sein.“ Insgesamt ist die Vereisungsgeschichte der Antarktis sehr kompliziert.
Um genauere Erkenntnisse zu gewinnen brach ein sechsköpfiges Forscherteam – darunter Prof. Melles – im Rahmen des Projektes „East Antartic Ice Sheet Instability“ Ende 2023 mit dem Forschungsschiff „Polarstern“ in die Antarktis auf. Vom 17. Dezember 2023 bis zum 5. Januar 2024 nahmen die Wissenschaftler rund 100 Meter Sedimentproben am Ellis Fjord. Dabei gab es einen Überraschungsfund: aus 46 Meter Tiefe wurde über 50.000 Jahre altes Moos gefunden. Das legt die Schlussfolgerung nahe, dass diese Region einmal eisfrei gewesen sein muss.
Drei Schlussfolgerungen gab der Wissenschaftler dem Auditorium mit auf den Weg:
- Der antarktische Eisschild ist eine wichtige Komponente des globalen Klimasystems
- Kenntnisse der Geschichte des Eisschilds helfen, zukünftige Entwicklungen besser zu verstehen
- In eisfreien Landgebieten der Antarktis lassen sich kleinräumige Änderungen der Eisbedeckung rekonstruieren
Prof. Dr. Sebastian Conrad
"Die Königin. Nofretetes globale Karriere" (30. 11. 2024)
Das Programm „Samstags um 12“ für die zweite Jahreshälfte 2024 steht! Alle drei Varianten – „Musik um 12“, „Literatur um 12“ und „Wissenschaft um 12“ des Formates sind mit faszinierenden Angeboten vertreten.
Los geht es am 26. Oktober 2024 mit „Musik um 12“ im Foyer des Hörsaalzentrums Unteres Schloss in Siegen. Mit Blick auf das Untere Schloss verwöhnen Michael Hönes (Klavier) und Emilie Bosch (Saxophon) mit einem Konzert zur Mittagszeit.
Am 09. November 2024 ist „Literatur um 12“ zu Gast im Aktiven Museum am Obergraben 10 in Siegen. Eva Gruberová und Helmut Zeller lesen aus ihrem Buch „Diagnose: Judenhass. Die Wiederkehr einer deutschen Krankheit“ (Verlag Beck). Eva Gruberová und Helmut Zeller sind durch Deutschland gereist und haben zugehört – von Rostock über Berlin und Dortmund und nach München, mit einem Abstecher nach Wien. Dabei zeigt sich, dass Juden hierzulande kein normales Leben führen können, es sei denn, man hält Polizei und Sicherheitszäune vor jüdischen Kindergärten, Brandanschläge auf Synagogen, oder perfide Witze für etwas, das zur deutschen Normalität gehört. Jüdinnen und Juden erleben Übergriffe und Anfeindungen auch aus muslimisch geprägten Milieus. Was aber viele nicht sehen: Antisemitismus kam und kommt aus der `bürgerlichen Mitte´. Die Reportagen, Interviews und Analysen machen sichtbar, dass der Judenhass tief in der Gesellschaft verwurzelt ist – und uns alle angeht.
Eva Gruberová arbeitet als Autorin und freie Journalistin; sie ist Referentin in der KZ Gedenkstätte Dachau und leitet Workshops zur NS-Geschichte, Rechtsextremismus und Antisemitismus für Jugendliche am Max-Mannheimer-Studienzentrum. Helmut Zeller leitet die Dachauer Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Moderation: Dr. Jens Aspelmeier
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals vielSeitig statt und wird finanziert aus Mitteln des Zukunftsfonds des Landes NRW für Maßnahmen gegen Antisemitismus. Der Eintritt ist frei! Tickets: tickets@lyz.de
Am 30. November 2024 geht es weiter mit „Literatur / Wissenschaft um 12“ (US – S 002, neben der Villa Sauer, Obergraben 25, 57072 Siegen). Seit 100 Jahren – also seit 1924 - ist die Büste der ägyptischen Königin Nofretete in Berlin zu sehen. „Die Königin – Nofretetes globale Karriere“ lautet der Titel des Sachbuchs von Prof. Dr. Sebastian Conrad (FU Berlin). Der Historiker Sebastian Conrad hat ein Buch über die vielfältigen Aspekte der ägyptischen Königin Nofretete, die im 14. Jahrhundert v. C. lebte, geschrieben. Er beleuchtet ihr Leben im Alten Ägypten an der Seite des Pharao Echnaton. Ein Schwerpunkt des Buches liegt in der Entdeckung ihrer weltberühmten Büste im Jahre 1912 und deren Weg nach Berlin mit der ersten öffentlichen Ausstellung vor genau 100 Jahren. Die Forderungen aus Ägypten zur Rückgabe der Büste sind seither immer wieder gestellt und von Deutschland ebenfalls immer ablehnend beantwortet worden. Der zweite Schwerpunkt beschreibt Nofretete als ein globales Phänomen und ihre weltweite Bewunderung als Schönheitsideal. Ihre größte Resonanz fand sie auf dem afrikanischen Kontinent und in der afroamerikanischen Community, wo sie als Schwarze Königin und afrikanische Schönheit betrachtet wird. Was aber ist der Grund dafür, dass ihre Büste an ganz unterschiedlichen Orten als Inbegriff weiblicher Schönheit verstanden wird und als Inspiration für internationale Stars wie Beyoncé oder Rihanna dient? Daneben gab es weitere, zahlreiche Vereinnahmungen von Nofretete und Ägypten von China und Indien über Mexiko bis Brasilien. Das Buch wird anhand einer Präsentation des Autors mit Bildern, der Lesung ausgewählter Stellen und in einer Gesprächsrunde vorgestellt. Moderation: Prof. Dr. Christian Berger (Universität Siegen, Kunstgeschichte)
Kurz vor Weihnachten steht eine Reise in die Antarktis an. Am 14. Dezember 2024 ist der Geologe Prof. Dr. Martin Melles (Universität zu Köln) zu Gast bei „Wissenschaft um 12“ (US – S 002, neben der Villa Sauer, Obergraben 25, 57072 Siegen). Sein Thema lautet: „Mit der ,Polarstern‘ in der Antarktis – Wie stabil ist der Eisschild der Antarktis gegenüber dem Klimawandel? In dem mächtigen Eisschild der Antarktis sind heute mehr als 90 Prozent der an Land auftretenden Eismassen gebunden. Sollte das Eisschild vollständig abschmelzen, dann würde der Meeresspiegel weltweit um 58 m ansteigen. Derzeit ist zu beobachten, dass große Teile des Eisschildes stark an Volumen verlieren, während andere Teile sogar einen Zugewinn erfahren. Die Gründe für dieses unterschiedliche Verhalten sind noch unzureichend verstanden. Wichtige Beiträge zu einem besseren Verständnis sollen die Ergebnisse von einer Expedition liefern, die im Südsommer 2023/24 mit dem deutschen Forschungsschiff „Polarstern“ durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser Expedition hat Martin Melles mit seinem Team geologische Proben aus einem eisfreien Gebiet genommen, von denen neue Erkenntnisse zur Vereisungsgeschichte erwartet werden, aber auch ein besseres Verständnis, was die Veränderungen in der Eisbedeckung verursacht hat und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die Zukunft ableiten lassen. In dem Vortrag werden die Motivation und die Herangehensweise der Forschungsarbeiten vorgestellt, aber auch ein Eindruck von den Geländearbeiten in der einzigartigen antarktischen Landschaft gegeben.
Eva Gruberová und Helmut Zeller
"Diagnose Judenhass: Die Wiederkehr einer deutschen Krankheit" (09. 11. 2024)
Am geschichtsträchtigen Datum 9. November waren die Autorin Eva Gruberová und der Autor Helmut Zeller bei „Literatur um 12“ zu Gast im Aktiven Museum Südwestfalen. Dabei hatten sie ihr Sachbuch „Diagnose Judenhass. Die Wiederkehr einer deutschen Krankheit“. Der Vortragsraum des Museums war voll besetzt. Die Gäste aus Dachau lasen im Wechsel Passagen ihres auf Interviews mit jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern basierenden Buchs vor. Deutlich wurde, dass jüdisches Leben in Deutschland stark von der Erfahrung von Antisemitismus geprägt ist. Vor allem im linken Polit-Spektrum, so die Autoren, habe sich nach dem Sechstagekrieg 1967 die Einstellung zu Israel geändert. Das habe Auswirkung auch auf den Umgang mit Jüdinnen und Juden in Deutschland. Die Betroffenheit ob der Interviewonhalte im Vortragsraum war groß. Entsprechend intensiv gestaltete sich die sich anschließende Diskussion
Dr. Marco Hoffmann und Emelie Bosch
Musik um 12 (26. 10. 2024)

Improvisation war am 26. Oktober gefordert. Kurzfristig musste Dr. Marco Hoffmann am Klavier für Michael Hönes einspringen. Nur eine Probe gemeinsam mit Emilie Bosch (Saxophon) war vor dem Konzert möglich. Und: Es lief alles rund. Rund 70 Musikbegeisterte lauschten im Foyer des Hörsaalzentrums Unteres Schloss dem jungen Musik und der Musikerin und spendeten reichlich Applaus.
Prof. Dr. Christian Berg
"Das gespaltene Haus" (29. 06. 2024)

„Ein in sich gespaltenes Haus kann keinen Bestand haben“ – Abraham Lincoln hielt 1858 seine „House-Divided-Rede“, basierend auf biblischer Grundlage. Im Blick hatte er die Frage der Sklaverei, die die USA spaltete. Drei Jahre später begann der Sezessionskrieg, der über 700.000 Opfer forderte.
„Das gespaltene Haus“ lautet der Titel des neuen Sachbuchs von Prof. Dr. Manfred Berg (Universität Heidelberg), das dieser im Rahmen von „Wissenschaft / Literatur um 12“ im Haus der Wissenschaft der Universität Siegen einer breiteren Öffentlichkeit vorstellte. Der Historiker zeichnete nach, wie die Konsenspolitik von Republikanern und Demokraten sich seit den 1950er Jahren allmählich in Richtung Polarisierung entwickelte und schlussendlich in Unversöhnlichkeit endete. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Siegener Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Daniel Stein.
Exemplarisch führte Berg den Konflikt „Pro-Choice versus Pro-Life“ um die Abtreibung an. Er verwies auf den „befriedenden Kompromiss“ in der Bundesrepublik. Berg: „In den USA dagegen eskalierte die Abtreibungsfrage zu einem hoch emotionalisierten Kulturkrieg, der nicht nur mit Worten ausgetragen wurde.“ Dabei, so Berg, habe die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner seit den 1970er Jahren eher pragmatische Positionen eingenommen. Am 22. Januar 1973 etablierte das Oberste Verfassungsgericht das Recht auf Abtreibung verfassungsrechtlich. Das Urteil Roe v. Wade habe einen „tragfähigen Konsens“ formuliert. Es billigte der Frau in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten das alleinige Entscheidungsrecht zu. Als Begründung galt ein impliziertes „right of privacy“, basierend auf der Verfassung und besonders deren 14. Verfassungszusatz von 1868.
2022 wurde das Urteil für ungültig erklärt, nachdem Donald Trump drei Richterstellen beim Supreme Court neu besetzt hatte. Berg: „Das Recht auf Abtreibung war schon längst unterhöhlt“ –sowohl durch rechtliche Einschränkungen als auch durch eine Einschränkung des Angebots für Schwangerschaftsabbrüche. Kliniken schlossen nicht zuletzt, weil das Personal massiv bedroht und teils getötet wurde. Berg: „Beide Seiten nahmen mehr und mehr absolutistische Positionen ein.“
Schon bevor Trump 2017 Präsident der Vereinigten Staaten wurde, habe er einen durchaus auch zweifelhaften „Status der Berühmtheit“ gehabt. Als Anwärter auf die Präsidentschaft sei er lange Zeit hinweg nicht ernst genommen worden. Getragen worden sei er von „einer amerikanischen Welle des Aufstiegs populärer Kulturen“. Zugute kam ihm bei seinem Wahlsieg, bei dem die Kontrahentin rund 3 Millionen Wählerstimmen mehr erhalten habe, dass Hillary Clinton „einen der schlechtesten Wahlkämpfe der neueren Geschichte“ geführt habe.
Die Präsidentschaftswahlen in den USA werden mittlerweile in nur sechs bis acht Bundesstaaten, den so genannten „swing states“ ohne vorab fixen Wahlausgang entschieden. Berg mit Blick auf die anstehende Wahl und das Resultat der ersten TV-Debatte zwischen Präsident Joe Biden und Herausforderer Donald Trump: „Die Demokraten brauchen ein politisches Wunder“. Bei einem knappen Wahlausgang sei denkbar, dass das Ergebnis von der jeweils unterlegenen Partei nicht anerkannt werde. In seinem Epilog stellt Berg die Frage: „Stehen die USA vor einem neuen Bürgerkrieg?“
Mirko Drotschmann
"Kampf um die Freiheit: Deutschlands Weg zur Demokratie" (08. 06. 2024)
Rund 200 Jahre dauerte es, bis Deutschland in seinen heutigen Grenzen eine Demokratie wurde – etwa von der Französischen Revolution 1789 bis zum Mauerfall zwischen den beiden deutschen Staaten 1989. Eine lange Zeit auch des Kämpfens und Streitens, der Niederlagen und erneuten Anläufe. „Kampf um Freiheit. Deutschlands Weg zur Demokratie“ lautete der Titel des Wissenschaftskommunikators Mirko Drotschmann bei „Samstags um 12“ (Haus der Wissenschaft) im Rahmen der Offenen Uni am Campus Unteres Schloss in Siegen. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit „Forum Siegen“ statt.
Rund 500 Besucherinnen und Besucher lauschten im Schadeberg-Hörsaal dem Vortrag Drotschmanns und diskutierten im Nachgang mit dem bekannten YouTuber und TerraX-Moderator. Selbstverständlich durften zum Anschluss auch Selfies mit dem bekannten Gast nicht fehlen.
ZUm Thema: Das Streben nach Demokratie keimte in Deutschland mit dem Beginn der Französischen Revolution. Von März bis Juli 1793 existierte im linksrheinischen Gebiet zwischen Landau und Bingen die sogenannte „Mainzer Republik“. Unter französischem Regiment gab es Wahlen zu einem Deutschen Nationalkonvent. Der Rheinisch-Deutsche Freistaat wurde mit 30 Kanonenschüssen begrüßt, war aber nicht von langer Dauer. Mainz ergab sich am 22./23. Juli den preußischen Belagerern. Erarbeitet worden war binnen weniger Wochen die Vorstufe einer Verfassung, in der das Volk als Souverän verankert ist.
1794 wurden die linksrheinischen Gebiete erneut von Napoleon eingenommen. Nach seiner Niederlage bei Waterloo und mit dem Wiener Kongress war es erst einmal um die freiheitlichen Bewegungen in Deutschland geschehen. Die Restitution setze ein.
Bevölkerungszuwachs und Verarmung sowie wirtschaftliche Unzufriedenheit führten dazu, dass es in den 1840er Jahren in Europa erneut gärte. Und wieder sprang der Funke von Frankreich nach Deutschland über. Monarchen und Fürsten mussten 1848 auf Forderungen nach Demokratisierung eingehen. In der Frankfurter Paulskirche rangen vor allem gut gebildete Männer um eine Verfassung. Doch auch diese Bewegung scheiterte. Drotschmann: „Einzelne Errungenschaften aber bleiben bestehen“.
Der weitere Weg Deutschlands führte über die Kaiserkrönung von Versailles m Jahr 1871 bis hin zum Ersten Weltkrieg und der Niederlage des Deutschen Reichs. In der Folge herrschte bittere Armut in Deutschland. Die Unzufriedenheit wuchs – keine guten Voraussetzungen für die Weimarer Republik. Gewählt wurde Anfang 1919. Erstmals hatten auch Frauen das Wahlrecht. Rund 83 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung stimmten ab, in der „Mainzer Republik“ von 1793 waren dies gerade einmal 8 Prozent gewesen. Drotschmann: „Die Staatsgewalt sollte beim Volk liegen. Die Verantwortlichen haben mit Blick auf die Verfassung in die USA, nach Frankreich und auf die Paulkirchenverfassung von 1848 geschaut.“ Und: „Die Menschen haben sich einen starken Ersatz-Kaiser gewünscht.“ So entstand das Amt des Reichspräsidenten.
Friedrich Ebert unterschrieb die Verfassung am 11. August 1919 in Schwarzburg in Thüringen. Drotschmann: „Die Demokratie stand von Anfang an unter Beschuss.“ Der Versailler Vertrag, zu zahlende Reparationen, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise und große Armut führten dazu, „dass die Menschen wieder empfänglich waren für Propaganda“. Das erkannte Ende der 1920er Jahre auch Joseph Goebbels. Er propagierte die Zerschlagung der Demokratie mit ihren eigenen Mitteln, aus dem Reichstag heraus. Als Reichspräsident Paul von Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannte, war es 1933 um die freiheitliche Verfassung geschehen.
Infolge des Naziregimes und des von diesem ausgelösten 2. Weltkrieg verloren über 60 Millionen Menschen ihr Leben, weite Teile Europas und der Welt waren zerstört, Deutschland wurde geteilt. Nach Kriegsende galt es, unter Regie der drei Westmächte in Westdeutschland Verfassungen zu erarbeiten und Parlamente zu wählen. Das Grundgesetz erwuchs aus dem Parlamentarischen Rat, dem 61 Männer und vier Frauen angehörten. „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“, lautet auf der Basis vor allem der Erfahrungen aus der Zeit des Terrorregimes der Nationalsozialisten § 1 des Grundgesetzes.
Das Grundgesetz galt als Provisorium bis zu einer Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Die Mauer fiel 1989 – das Grundgesetz gilt seit dem 3. Oktober 1990 für die gesamte Bundesrepublik Deutschland, inklusive der „neuen“ Bundesländer. Das Fazit Drotschmanns: „Mit Blick auf die zurückliegenden 200 Jahre lohnt es, sich für diese Demokratie einzusetzen.“ Auch heute gebe es wieder wirtschaftliche Schwierigkeiten und Unzufriedenheit. Drotschmann: „Der Unterschied zu Weimar besteht darin, dass es heute viel mehr überzeugte Demokratinnen und Demokraten gibt als damals.“
Alexander Zolotarev
Musik um 12: Klaviermatinee (20. 01. 2024)
Eine Klaviermatinee bildete den Abschluss des Formats „Samstags um 12“ des Hauses der Wissenschaft der Universität Siegen im laufenden Wintersemester. „Musik um 12“ basiert auf einer Kooperation mit dem Institut für Musik. Zu Gast im Foyer des Unteren Schlosses in Siegen war der Pianist Alexander Zolotarev. Rund 100 Gäste begrüßen Prof. Martin Herchenröder (Musik) und Katja Knoche (HDW) bei sonnigem Winterwetter in der „guten Stube“ der Universität.
Zolotarev, der über Jahre hinweg Lehraufträge an der Universität Siegen innehatte, begann mit drei Stücken von Peter Tschaikowski. Musikalisch entführte er mit „Dumka“ in eine ländliche russische Szene. Es folgten „Tendre reproches (op. 72, Nr. 3) und die „Meditation“ (Op. 72, Nr.5). Alsdann spielte Zolotarev die „Kreisleriana“ (op.16). Die Kreisleriana sind ein 1838 komponierter Klavierzyklus von Robert Schumann, der als ein Schlüsselwerk der romantischen Klavierliteratur gilt. Generationen von Musikern und Musikwissenschaftlern haben sich den Kopf über den Sinn des Titels zerbrochen. Schumann meinte, er sei „nur von Deutschen“ zu verstehen, denn der „exzentrische, wilde und geistreiche Kapellmeister“ Johannes Kreisler war eine literarische Figur von E. T. A. Hoffmann, die nur in Deutschland und auch dort nur in der Hochromantik einige Berühmtheit erlangte.
Dr.in Susanne M. Hoffmann
"Der Stern von Bethlehem" (02. 12. 2023)

Auf weihnachtliche Spurensuche ging am Samstag bei „Wissenschaft um 12“ im Hörsaalzentrum Unteres Schloss der Universität Siegen Dr. Dr. Susanne M Hoffmann von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Die Wissenschaftshistorikerin und Astrophysikerin beschäftigte sich und ihr rund 50-köpfiges Publikum mit Überlieferungen von Himmelskonstellationen von vor rund 2000 Jahren. Ihr Vortrag trug den Titel „Der Stern von Bethlehem – eine Spurensuche“.
Susanne Hoffmann: „Das Rätsel des Sterns von Bethlehem ist rund 2000 Jahre alt“. Es basiert auf Schilderungen des Matthäus-Evangeliums. Weise aus dem Morgenland kamen demnach nach Jerusalem, um den neu geborenen König der Juden zu finden und zu ehren. Geleitet wurden sie von einem Stern. Die Weisen, so Hoffmann, kamen vermutlich aus Babylon, „dem damaligen Sitz der ESA“, merkte sie humorvoll an. Gemäß der alten jüdischen Überlieferung soll der Messias aus Bethlehem kommen, woher auch Vorfahren von König David stammten.
Der Stern zog vor den Weisen her und wies ihnen die Richtung. Hoffmann: „Der Stern und die Karawane bewegten sich also.“ Deshalb habe es sich vermutlich um einen länglichen Himmelskörper gehandelt, der eine Zeigerichtung aufweise. Unter einem Stern, so die Astrophysikerin, sei ein Lichtpunkt oder besser ein Gestirn zu verstehen. Die längliche Form könnte durch eine Ansammlung von Lichtpunkten zu erklären sein (zwei oder mehrere Gestirne stehe dicht beieinander und bilden eine Konjunktion), durch einen Kometen (Objekte, die die mit zumeist langer Umlaufzeit die Sonne umkreisen, deren Schnee in der Nähe der Sonne verdampft und einen Schweif bildet), um eine klassische Nova oder aber eine Supernova (ein massereicher Stern, der am Ende seines Lebens explodiert).
Die letzte Supernova wurde 1604 verzeichnet, zu Lebzeiten des Astronomen Johannes Kepler. Kepler entwickelte mit Blick auf den Stern von Bethlehem die lange gängige Standardhypothese, dass es sich bei der Himmelserscheinung um eine Konjunktion von Jupiter und Saturn gehandelt habe, die für das Jahr - 7 (vor Christi Geburt) überliefert ist. Diese Konjunktion habe im Sternzeichen Fische stattgefunden, was wegen der Darstellung mit (Nabel-)Schnüren auch als Zeichen der Geburt gewertet worden sei. Diese Darstellung, so Hoffman, erweise sich bei näherer Betrachtung als nicht haltbar. Saturn werde als Planet der Juden beschrieben, eines fischfangenden Volkes am Mittelmeer. Die Hafenstadt Jaffa habe zur Zeit des römischen Kaisers Augustus aber zu Ägypten gehört. Das Sternbild Fisch habe in der damaligen Zeit in besagter Form nicht existiert, sei eher eine Schwalbe gewesen.
Historische Bibliotheken weisen Berichte aus China auf, die von einem diffusen Stern um - 4 / - 5 vor Christus berichten, der am späten Abendhimmel zu sehen gewesen sei. Es sei aber eher unwahrscheinlich, so Susanne Hoffmann, dass dieser Stern in Jerusalem zu sehen gewesen war. Die Aufzeichnungen berichteten zudem von einem „Besenstern“, also einem Unheilsbringer. Gleiches gilt auch für besagte Konjunktion von Jupiter und Saturn. Saturn galt als „böser“ Planet.
Unter einem sprichwörtlich guten Stern indes stand im Jahr - 2 / - 3 vor Christus die Jupiter-Venus-Konjunktion. Hoffmann: „Diese war mit dem bloßen Auge zu erkennen. Auch die Hirten auf dem Felde konnten sie sehen.“ Dabei handelte es sich um zwei helle Lichtpunkte, die optisch aufeinander zuliefen, um als ein Lichtpunkt zu erscheinen. Die Konjunktion stand genau neben Regulus. Regulus ist der hellste Stern (Hauptstern) im Sternbild Löwe. Der lateinische Name bedeutet kleiner König oder Prinz. Hoffmann: „Das hatte garantiert Einfluss auf die Menschen der damaligen Zeit.“ Hinzu komme die Augustus-Propaganda, die in den Köpfen der Menschen war – Augustus als Friedensbringer mit der Abbildung des Mischwesens Capricorn aus der Zeit sein
Prof. Dr. Ewald Frie
"Ein Hof und elf Geschwister" (25. 11. 2023)

Die stolze bäuerliche Landwirtschaft mit Viehmärkten, Selbstversorgung und harter Knochenarbeit ist im Laufe der Sechzigerjahre in rasantem Tempo und doch ganz leise verschwunden. Ewald Frie erzählt am Beispiel seiner Familie von der großen Zäsur. Mit wenigen Strichen, anhand von vielsagenden Szenen und Beispielen zeigt er, wie die Welt der Eltern unterging, die Geschwister anderen Lebensentwürfen folgten und der allgemeine gesellschaftliche Wandel das Land erfasste.
Zuchtbullen für die monatliche Auktion, Kühe und Schweine auf der Weide, Pferde vor dem Pflug, ein Garten für die Vorratshaltung – der Hof einträglich bewirtschaftet von Eltern, Kindern und Hilfskräften. Das bäuerliche Leben der Fünfzigerjahre scheint dem Mittelalter näher als unserer Zeit. Doch dann ändert sich alles: Einst wohlhabende und angesehene Bauern gelten trotz aller Modernisierung plötzlich als ärmlich und rückständig, ihre Kinder riechen nach Stall und schämen sich. Wege aus der bäuerlichen Welt weist die katholische Kirche mit neuer Jugendarbeit. Der Sozialstaat hilft bei Ausbildung und Hofübergabe. Schon in den Siebzigerjahren ist die Welt auf dem Land eine völlig andere. Staunend blickt man zurück, so still war der Wandel: «Mein Gott, das hab ich noch erlebt, das kommt mir vor wie aus einem anderen Jahrhundert.» Ewald Frie hat seine zehn Geschwister, geboren zwischen 1944 und 1969, gefragt, wie sie diese Zeit erlebt haben. Sein glänzend geschriebenes Buch lässt mit treffsicherer Lakonie den großen Umbruch lebendig werden. (Quelle: Verlag Beck)
Prof. Dr. Ralf Schnell, Gerd Doege, Carin Levine, Prof. Martin Herchenröder
"Die Spuren sind der Weg" - Konzert, Lesung, Kunstausstellung (06. 05. 2023, Martinikirche Siegen)
„Die Spuren sind der Weg“ lautet der Titel des Bandes, der im Rahmen von „Samstags um 12 / Musik um 12“ in der Martinikirche in Siegen präsentiert wurde. Das Buch umfasst 33 Texte aus der Feder von Alt-Rektor Prof. Dr. Schnell, die von Künstler Gerd Doege bebildert wurden. Dazu gab es Musik von Prof. Martin Herchenröder (Komposition, Klavier). Unterstützt wurde er von Carin Levine (Flöte).









